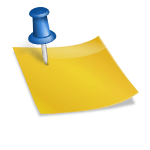Risiko und Rendite bei Geldanlagen: Die untrennbare Verbindung verstehen
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comJede Investitionsentscheidung basiert letztlich auf zwei grundsätzlichen, fundamentalen Fragen, die für jeden Anleger, jede Bank, jeden Finanzberater und jeden, der sein Vermögen anlegen möchte, von zentraler Bedeutung sind: Erstens, welche Rendite möchte ich mit meiner Geldanlage erzielen? Das heißt: Welche Erträge strebe ich an, um mein Vermögen wachsen zu lassen oder zumindest zu erhalten? Und zweitens, wie viel Risiko bin ich bereit, im Rahmen dieser Investition zu tragen, um diese Rendite zu erreichen? Diese beiden Fragen scheinen auf den ersten Blick voneinander getrennt zu sein – eine nach der gewünschten Rendite, die andere nach der persönlichen Risikobereitschaft. Doch bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass sie eine untrennbare Einheit bilden. Denn, so lässt sich feststellen, handelt es sich um zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingen und kaum voneinander zu trennen sind. Es ist ein Fehler, diese Fragen getrennt zu betrachten, weil sie in Wirklichkeit eine komplexe Einheit darstellen, die nur gemeinsam eine sinnvolle Entscheidung ermöglicht. Dieser Zusammenhang ist für jeden Investor, der langfristig Vermögen aufbauen möchte, von entscheidender Bedeutung: Die Beziehung zwischen Rendite und Risiko ist keine einfache, lineare Gegenüberstellung, sondern vielmehr eine enge Verbindung, die in der Praxis kaum zu trennen ist. Nur wer den Mechanismus dieser Verbindung – insbesondere die sogenannte Risikoprämie – versteht, ist in der Lage, rationale, gut durchdachte Entscheidungen zu treffen. Das Ziel ist, die Balance zwischen Ertrag und Risiko so zu steuern, dass die persönliche Risikobereitschaft nicht überschritten wird, gleichzeitig aber die angestrebte Rendite erreichbar bleibt.
Die Illusion der einfachen Risikoabschätzung
Trotz dieser unbestrittenen Verbindung zwischen Risiko und Rendite versuchen viele Anleger, Finanzberater und auch sogenannte „Roboadvisor“ das Thema Risiko stark zu vereinfachen. Sie greifen auf sogenannte Risikoprofile zurück, die meist nur durch Begriffe wie „sicherheitsorientiert“, „konservativ“, „ausgewogen“, „chancenorientiert“ oder „spekulativ“ beschrieben werden. Diese Begriffe sind häufig nur schwammig definiert und dienen vor allem der Vereinfachung. Sie lassen den Anleger im Unklaren darüber, was diese Kategorie konkret bedeutet, und verleiten viele dazu, eine Wahl zu treffen, ohne die tatsächlichen Risiken zu verstehen. Bei einem Verkaufsgespräch wird dem Kunden meist nur eine vage Auswahl präsentiert: Es gibt fünf Risikoprofile, die er nur anhand eines Namens unterscheiden soll. Die Frage „Welches Schweinderl hätten’s denn gern?“ ist dabei fast schon Programm. Es ist offensichtlich, dass der Verkäufer kaum detailliert erklärt, was dieses Risikoprofil in der Realität bedeutet. Stattdessen wird der Kunde oft nur dazu verleitet, eine sozial erwünschte, sogenannte „mittel“ oder „ausgewogen“ zu wählen, weil das am wenigsten auffällt. Diese Wahl klingt zwar vernünftig, ist aber inhaltlich wenig aussagekräftig. Was bedeutet „ausgewogen“ konkret? Was kann ich in schlechten Zeiten verlieren? Wie viel bleibt nach 20 Jahren noch übrig? Hier herrscht meist Schweigen. Denn die meisten Anleger, vor allem Laien, bekommen kaum eine klare Antwort auf diese Fragen. Es bleibt häufig bei vagen Annahmen, die kaum eine tatsächliche Orientierung bieten.
Kurzfristige Orientierung und ihre Tücken
In der Praxis ist die kurzfristige Orientierung bei den meisten Anlageentscheidungen besonders ausgeprägt. Der Verkäufer spricht oft nur von drei bis fünf Jahren Laufzeit, ohne die langfristigen Folgen zu berücksichtigen. Dabei wird dem Anleger meist nur die Wahl zwischen den verschiedenen Risikoprofilen abgenommen, ohne ihn wirklich auf die Konsequenzen vorzubereiten. Das Ergebnis: Die meisten Anleger tippen auf die Mitte, weil „ausgewogen“ am besten klingt. Das bedeutet: Sie wählen meistens die mittlere Risikokategorie, ohne sich wirklich mit den möglichen Verlusten auseinanderzusetzen. In der Folge wird das Produkt, das sie kaufen, mit einer Provision von fünf Prozent und einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 1,8 Prozent beworben. Was „ausgewogen“ aber im Detail bedeutet, bleibt im Dunkeln. Was kann ich im schlimmsten Fall verlieren? Wie viel wird nach 20 Jahren noch übrig sein? Oft erhält der Anleger keine klare Antwort, weil diese Fragen in der Praxis kaum beantwortbar sind. Stattdessen wird die Diskussion auf die vermeintlich sicheren, kurzfristigen Gewinne gelenkt. Und in diesem Kontext spielt die tatsächliche Risikolage kaum eine Rolle.
Die Gefahr der kurzfristigen Perspektive
Das Problem ist, dass die meisten Anleger in der Regel nur auf die nächsten drei bis fünf Jahre schauen. Sie wollen wissen, was kurzfristig passiert, und sind daher kaum in der Lage, die langfristigen Risiken richtig einzuschätzen. Dies führt dazu, dass sie in Krisenzeiten oft panisch reagieren und ihre Anlagen verkaufen, um weitere Verluste zu verhindern. Doch genau diese Reaktion ist der größte Fehler, weil sie die Verluste nur verschärft. Die meisten Anleger, die in einer Krise ihre Reißleine ziehen, erleben später, dass sich die Märkte erholen – nur ihre Depots bleiben im Rückstand. Dieses Verhalten ist kein Einzelfall, sondern die Regel bei diesem Risiko-Management. Es ist die sogenannte „Rentenfalle“: Man versucht, Risiken zu vermeiden, doch das Ergebnis ist eine dauerhafte Vermögensverschlechterung. Das paradoxe Ergebnis: Das Streben nach Sicherheit führt häufig zu dauerhaften Verlusten und damit zu einer dauerhaften Verschlechterung des Lebensstandards. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, die viele Anleger vor eine harte Wahrheit stellt: Das Beherrschen des Risikos ist in der Praxis viel schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint.
Das Risiko besser verstehen: Risikoprämie und Volatilität
Ein wichtiger Schritt, um Risiken richtig einschätzen zu können, besteht darin, die Mechanismen der Risikoprämie zu verstehen. Diese Risikoprämie ist der Zusatzgewinn, den Anleger für das Eingehen eines Risikos erwarten. Nur wenn man versteht, warum man für das Risiko belohnt wird, kann man eine rationale Entscheidung treffen. Ein häufig verwendeter Begriff ist die Volatilität – ein Risikomaß, das die Schwankungsbreite eines Basiswerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums misst. Obwohl die Volatilität in der Finanzbranche eine zentrale Rolle spielt, ist sie für den Laien kaum verständlich. Was bedeutet viel Volatilität? Was wenig? Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Zahl? Wochen, Monate, Jahre? Handelt es sich um historische oder implizite Volatilität? Diese Fragen bleiben meist unbeantwortet, weil die Kennzahlen nur schwer interpretierbar sind. Zudem neigen Anleger dazu, die Schwankungen für normal zu halten, wie es die Gauß’sche Glockenkurve nahelegt. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Besonders in Krisenzeiten steigen die Schwankungen deutlich an. Es kommt zu heftigen Kurseinbrüchen, die die Standard-Modelle der Normalverteilung deutlich übersteigen. Deshalb ist die Volatilität nur eine ungefähre Orientierung, die in Krisenzeiten ihre Aussagekraft verliert.
Die Grenzen der Risikomessung
Die Messung des Risikos anhand der Volatilität ist also nur eine Annäherung. Bei der Frage „Was bringt mir eine Ein-Jahres-Volatilität von 28 % im DAX?“ ist die Antwort nur schwer greifbar. Es ist kaum möglich, den individuellen Einfluss dieser Zahl auf die eigene Lebensplanung zu bestimmen. Eine bessere Alternative ist das Konzept des „Value at Risk“ (VaR). Dieses versucht, die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Verlustes in einem bestimmten Zeitraum zu quantifizieren. So wird bei einem jährlichen VaR von 10 % und einem Konfidenzniveau von 95 % angenommen, dass mit 95 % Wahrscheinlichkeit ein Verlust von maximal 10 % nicht überschritten wird. Doch auch dieses Modell hat Grenzen. Es wird häufig so dargestellt, als könnten Risiken exakt berechnet und kontrolliert werden. In der Praxis scheitern viele Fondsmanager an diesen Modellen regelmäßig, beispielsweise während des ersten Coronacrashs. Ein prominentes Beispiel: Ein Fondsmanager, der dieses Risiko-Management hoch lobt, erreichte innerhalb kurzer Zeit fast genau den maximal definierten Verlust – trotz der Marketingversprechen. Trotz zahlreicher Erklärungen, warum die Früherkennung versagte, bleibt die Realität: Das Risiko wurde falsch eingeschätzt. Für Anleger ist das eine Katastrophe. Um größere Verluste zu vermeiden, wird die Aktienquote in der Krise stark reduziert. Das nennt man die sogenannte „Rentenfalle“. Das Ergebnis: Während sich die Märkte erholen, bleibt das Vermögen der Kunden oft hinterher. Das ist keine Ausnahme, sondern die Regel bei dieser Art des Risikomanagements. Das Streben, Risiken vollständig beherrschbar zu machen, führt paradoxerweise immer wieder zu dauerhaften Vermögensverlusten und zu einem geringeren Lebensstandard. Das ist zunächst eine ernüchternde Erkenntnis, die vielen Anleger die Illusion raubt, das Risiko vollständig kontrollieren zu können.
Neue Perspektiven: Risiko und Rendite neu verstehen
Angesichts dieser Erkenntnisse lohnt es sich, das Thema Risiko und Rendite aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Statt nur zu fragen: „Wie viel Rendite will ich?“ sollte man sich vor allem fragen: „Für wie viel (erwartete) Rendite muss ich hohe (potenzielle) Rückschläge in Kauf nehmen?“ Ebenso ist entscheidend, welche Risiken vermeidbar sind und welche kaum zu kontrollieren sind. Und letztlich gilt: Wie riskant ist es, überhaupt nichts zu tun?
Realistische Einschätzung der Rendite und der Risiken
Der erste verantwortungsvolle Schritt besteht darin, die tatsächlichen, realistischen Renditen zu kennen. Hierbei ist es sinnvoll, sich die historischen Daten für die USA anzuschauen, da diese eine deutlich längere Datenbasis bieten als Deutschland. Die Zahlen für den Zeitraum von 1900 bis 2019 zeigen: Bei einer global gestreuten Aktienanlage lag die inflationsbereinigte durchschnittliche Rendite in diesen 120 Jahren bei lediglich 5,2 %. Das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, doch bei genauerer Betrachtung ist das eine respektable Zahl, wenn man die Vielzahl von Krisen, Kriegen, Weltwirtschaftskrisen, Diktaturen, dem Kalten Krieg, Ölkrisen, Dotcom-Blasen, Terroranschlägen und Finanzkrisen berücksichtigt. Trotz aller Katastrophen hat sich das Vermögen real um durchschnittlich 5,2 % pro Jahr erhöht. Das zeigt, dass die Realität rau ist, aber nicht unmöglich, und dass diese Rendite bei Tageslicht betrachtet durchaus akzeptabel ist. Es ist eine nüchterne Einsicht, die den Blick auf die tatsächlichen Möglichkeiten schärft.
Risiken richtig einschätzen: Das eigene Risikoprofil finden
Der zweite Schritt besteht darin, die eigenen Risiken realistisch zu bewerten. Hierbei ist es wichtig, die Risiken der einzelnen Anlageklassen zu kennen und zu differenzieren: Welche Risiken sind systematisch, also marktbedingt, und welche sind unsystematisch, also einzel- oder branchenspezifisch? Bei Aktien und Anleihen – die wichtigsten Anlageklassen – lassen sich die unsystematischen Risiken durch breite Diversifikation fast vollständig eliminieren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Immobilien, bei denen das Risiko auf eine einzelne Immobilie konzentriert ist. Insgesamt ist der Kapitalmarkt kein Nullsummenspiel: Wer klug investiert, kann von der Kraft des Marktes profitieren, die in den letzten 200 Jahren eine erstaunliche Wohlstandsschöpfung bewirkt hat. Das zentrale Prinzip: Freies Unternehmertum, Marktwirtschaft und Kapitalismus sind die treibenden Kräfte. Trotz aller Kritik an einzelnen Aspekten dieses Systems ist das Grundprinzip funktionierend und alternativlos. Es ist im Kern simpel: Ein Unternehmer braucht für die Produktion Rohstoffe, Arbeitskraft und Kapital. Diese Faktoren müssen langfristig bezahlt werden: Rohstoffe werden eingekauft, Mitarbeiter entlohnt, und das Kapital wird durch Investitionen bereitgestellt. Für den Anleger bedeutet das: Er tritt als Risikoträger auf, erhält aber eine Entschädigung für das Risiko, dass die Idee des Unternehmers scheitert.
Die große Falle: Kontrolle und Kontrolle verlieren
Hier liegt die große Illusion: Viele Anleger glauben, durch Diversifikation und Kontrolle könnten sie die Risiken steuern, wie es Unternehmer in ihrem Geschäft tun. Doch das ist eine große Fehleinschätzung. Als Investor haben Sie keinen Einfluss auf die Unternehmen, in die Sie investieren, und Sie verfügen auch nicht über den Informationsvorsprung, den Unternehmer in ihrem Business genießen. Sie sind auf die Marktentwicklung angewiesen, ohne aktiv eingreifen zu können. Unternehmer steuern aktiv ihre Geschäfte, erkennen Chancen, reagieren flexibel und gehen Risiken ein. Für den Investor gilt das Gegenteil: Er kann nur abwarten, hoffen und auf die langfristige Entwicklung setzen. Dieses Missverständnis – die irrige Annahme, Risiken seien beherrschbar – ist eine der größten Fallen im Bereich der Kapitalanlage. Sie führt dazu, dass Anleger Risiken unterschätzen und im Ernstfall schwerwiegende Verluste erleiden.
Inflationsrisiko: Die verborgene Gefahr
Ein weiterer, oft unterschätzter Risikofaktor ist die Inflation. Viele Menschen glauben, dass nur eine Hyperinflation wie 1923 gefährlich ist. Doch die normale Inflation – die in Deutschland bei durchschnittlich 1 bis 3 Prozent liegt – ist die eigentliche Gefahr. Denn sie schleichend entwertet das Vermögen, wenn es ausschließlich auf dem Girokonto liegt oder in Lebensversicherungen, die kaum gegen die Inflation geschützt sind. Mehr als 70 % des deutschen Geldvermögens befinden sich in solchen Anlagen. Das Ergebnis: Das Vermögen schmilzt langsam, aber stetig dahin, ohne dass der Anleger es bemerkt. Das unüberlegte Horten von Bargeld, das im Zuge der Niedrigzinsphase noch verstärkt wurde, ist kein sinnvoller Schutz vor Inflation, sondern eine gefährliche Strategie. Über Jahre hinweg verliert das Vermögen an Wert, was die Lebensqualität im Alter erheblich schmälern kann. Es ist eine schleichende Gefahr, die viele unterschätzen.
Das Risiko des Zauderers: Das ewige Abwarten
Viele Anleger reagieren auf die Unsicherheiten an den Märkten mit einer Art Dauerzögerlichkeit. Sie sagen: „Jetzt ist es noch zu unsicher“, oder „die Kurse sind zu volatil“, und verschieben Investitionen immer wieder. Die Begründungen sind vielfältig: „Die Märkte sind zu hoch gelaufen“, „die Unsicherheit ist zu groß“, „ich warte auf bessere Zeiten“. Doch diese Haltung ist eine teure Falle. Sie führt dazu, dass man bei Kursverlusten – etwa während der Coronakrise – nie rechtzeitig wieder einsteigt. Stattdessen verpasst man die Erholungen und erleidet auf lange Sicht enorme Vermögensverluste. Bei einer Inflation von 2,5 % und einer Anfangsinvestition von einer Million Euro bedeutet das in 20 Jahren einen Kaufkraftverlust von über 257.000 Euro. Das ist eine schleichende Wertminderung, die sich kaum bemerkt, aber langfristig erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lebensqualität hat. Das Verhalten des Abwartens ist daher eine der teuersten Strategien, die man wählen kann.
Die Kunst des Risiko-Managements
Was lässt sich daraus lernen? Wichtig ist, das Risiko realistisch zu verstehen und es richtig zu steuern. Es geht nicht darum, kurzfristige Verluste komplett zu vermeiden, sondern vielmehr darum, den eigenen Lebensentwurf und die persönlichen Ziele zu schützen. Risiko bedeutet vor allem, dass man im Falle grober Fehler den Lebensstandard nach unten korrigieren muss. Deshalb gilt: Die eigene Risikobereitschaft sollte gut bekannt sein, und die Kapitalanlage sollte entsprechend ausgerichtet werden. Dazu gehört eine breite Diversifikation, das bewusste Vermeiden systematischer Risiken und eine angemessene Liquiditätsreserve. Wenn man diese Prinzipien beachtet, kann man auch in Krisenzeiten ruhig und besonnen bleiben und langfristig Vermögen aufbauen. Denn die eigentliche Kunst besteht darin, die eigenen Emotionen im Griff zu behalten und das Risiko nicht als Bedrohung, sondern als integralen Bestandteil der Geldanlage zu akzeptieren. Nur so lässt sich eine Balance zwischen Risiko und Rendite finden, die den eigenen Zielen und der individuellen Belastbarkeit entspricht – für mehr Sicherheit, Lebensqualität und finanzielles Wohlbefinden im Alter.