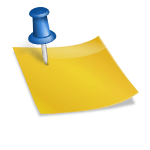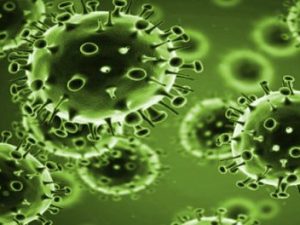Kreißsaal – Hörsaal – Kreißsaal: Ein authentischer Einblick in den Alltag von Hebammen!

Manchmal sind Entbindungsstationen und Kreißsäle in Deutschland derart überfüllt mit Geburten oder so stark unterbesetzt, dass sie sich zeitweise von der Versorgung abmelden müssen. Für Frauen, die genau in diesen Momenten mit Wehen oder anderen Anzeichen einer bevorstehenden Geburt ihre gewünschte Klinik aufsuchen, bedeutet das, dass sie dort nicht aufgenommen werden können. Einer Studie zufolge musste im Jahr 2018 jede dritte Geburtsklinik mindestens einmal eine Schwangere mit Wehen wegen Personalmangel und fehlender Kapazitäten abweisen.
Das Abmelden von Krankenhäusern, also das Sperren von Betten, ist ein komplexes Thema. Auf der Station, auf der ich arbeite, erleben wir solche Situationen immer wieder. Denn Medizin lässt sich weder planen noch exakt vorhersagen – Intensivmedizin erst recht nicht – und auch Babys, die bereit sind, das Licht der Welt zu erblicken, koordinieren sich leider nicht untereinander. Manchmal wollen einfach zu viele gleichzeitig geboren werden. Jede Hebamme kennt die berüchtigten Vollmondnächte, an denen es auf der Entbindungsstation zugeht wie in einem Bienenstock. In jedem Krankenhaus und auf jeder Station – sei es in der Altenpflege, bei Neugeborenen oder auf der Intensivstation – gibt es Phasen mit enormer Arbeitsverdichtung. Manchmal hat man zufällig mehrere schwere Verletzungen gleichzeitig zu versorgen: Patienten mit großen Wunden, vielen Drainagen, zeitaufwändigen Verbandswechseln sowie zahlreichen Fahrten in den OP oder zur Diagnostik. Genauso erleben Hebammen oft mehrere unkomplizierte Geburten parallel – doch plötzlich kommen mehrere lange und komplizierte hinzu. Manchmal entwickeln sich zunächst unauffällige Patienten zu Notfällen oder es treten zusätzliche Notfälle hinzu.
Medizin gleicht nie einem ruhigen Meer. Vielmehr schwankt sie wie Ebbe und Flut – manchmal sogar wie eine Springflut. Jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß das und kann meist damit umgehen. Überlastungssituationen sind keine Seltenheit und traten auch früher bereits auf, selbst bei guter Personalbesetzung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung: Wir hatten solche Phasen schon häufig. Doch früher konnten wir sie besser bewältigen. War ein Kollege krank, wurde herumtelefoniert, um Ersatz zu finden. Auch wenn mal zwei Kollegen gleichzeitig ausfielen – das kam vor – konnten wir das ausgleichen.
Heute gibt es weiterhin Ebbe und Flut sowie Springfluten – gefühlt sogar mehr von Letzteren –, aber im Vergleich zu früher fällt es uns zunehmend schwerer, diese Situationen aufzufangen. Der Grund ist simpel: Wir sind insgesamt zu wenige. Aus gelegentlicher Unterbesetzung ist eine dauerhafte geworden. Eigentlich fehlt ständig jemand – sei es wegen unbesetzter Stellen oder Krankheit. Und Kollegen sind heute oft länger und häufiger krank als früher. Warum? Weil wir in diesem Beruf unsere Kräfte und unsere Seele stark beanspruchen – und wenn das überhandnimmt, wird man krank.
In Pflege- und Medizinberufen zählen Krankheitsausfälle aufgrund psychischer Leiden und Beschwerden des Bewegungsapparates inzwischen zu den häufigsten Ursachen für Fehltage. Mittlerweile schaut kaum noch jemand nach Ersatz, weil schlichtweg niemand mehr verfügbar ist. Das Herumtelefonieren hat sich erledigt. Übrig bleibt nur noch die Sperrung von Betten.
Wir melden also freie Betten von der Versorgung ab, um die Patienten zu schützen, die bereits da sind. Damit gewährleisten wir deren Versorgung und verhindern einen Qualitätsverlust in der Behandlung. Denn manche Krankheitsbilder erfordern eine Mindestanzahl an Personal; darunter leidet man schnell bei Unterbesetzung – Leben werden gefährdet! Im Grunde sind solche Abmeldungen deshalb eine Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und des Lebens der vorhandenen Patienten; für weitere reicht die Kapazität schlichtweg nicht mehr aus.
Ähnliches passiert in Kreißsälen: Ärzte und Hebammen können zwei bis drei, manchmal vier Geburten gleichzeitig betreuen – dann sind sie am Limit, was regelmäßig vorkommt. Kommt dann noch eine weitere Schwangere hinzu, weiß jeder Vernünftige: Das kann nicht mehr aufgefangen werden! Dann zieht man die Reißleine und sperrt.
So stehen in ganz Deutschland Betten leer, obwohl sie dringend gebraucht werden – weil Personal fehlt und sie daher nicht belegt werden können. Dann muss jemand wie Martin R., Anästhesist und Notarzt mit über zehn Jahren Erfahrung im Rettungsdienst, schauen, wo die Patienten untergebracht werden können. Er wird zu Unfällen, Herzinfarkten, Knochenbrüchen, Schlaganfällen oder Stürzen gerufen; er und seine Kollegen leisten vor Ort Erstversorgung und stabilisieren die Patienten für den Transport ins Krankenhaus. Anschließend gibt Renner in ein digitales Zuweisungssystem ein, welche Behandlung benötigt wird – etwa Innere Medizin oder Intensivbetten inklusive Beatmung. An vielen Tagen meldet das System jedoch: „Sorry, keine Betten frei.“ „Gesperrte Betten zeigt mir das System rot an“, sagt Martin R., „und es gibt mittlerweile viele Zeiten im Jahr, an denen im gesamten Kreis alle Bereiche rot markiert sind.“ Oder es kommt zur absurden Situation: Ein Patient bricht mitten in einer größeren Stadt zusammen – muss aber 30 bis 40 Kilometer außerhalb in eine ländliche Klinik gebracht werden, weil dort noch Kapazitäten vorhanden sind.
Auch ich beobachte genau wie Martin R., was vermutlich alle aus dem Gesundheitswesen bestätigen würden: Die Zahl der Abmeldungen von Krankenhäusern sowie die Sperrung von Betten und Kreißsälen steigen stetig an. Eine flächendeckende Erhebung gibt es bisher nur für den Intensivbereich aus dem Jahr 2018: Dort wurden auf 76 Prozent aller Intensivstationen Betten gesperrt; in 22 Prozent der Fälle sogar täglich. Wichtig ist dabei: Niemand bleibt deswegen einfach liegen! Jedes Krankenhaus hat einen sogenannten Versorgungsauftrag – das bedeutet: Ein Notfall muss auch dann aufgenommen werden, wenn offiziell keine Kapazitäten vorhanden sind und alle Betten als „rot“ markiert sind. „Dieser Mensch wird versorgt und sicher auch adäquat behandelt“, erklärt R… „Aber man muss davon ausgehen, dass dabei Ressourcen an anderer Stelle entzogen werden – genau dort also, wo sie ebenfalls dringend gebraucht werden, nur momentan nicht ganz so akut wie beim Notfall.“
Insofern hat ein Mensch in einer Notfallsituation sogar etwas mehr Glück als eine Frau in den Wehen: Der Notfall wird versorgt; eine Frau ohne Komplikationen jedoch nicht unbedingt sofort aufgenommen – denn sie ist kein Notfall! Sie ist eine Frau mit Schmerzen und Sorgen; sie braucht Betreuung sowie ein sicheres medizinisches Umfeld – doch im Zweifel muss sie warten, bis klar ist, wo ein Platz frei wird; dann erst kann sie dorthin gebracht werden.
Unter solchen Bedingungen entstehen keine guten Geschichten! Und betroffen sind längst nicht nur Frauen mit ihren Familien; auch von der anderen Seite des Bettes gibt es immer häufiger Berichte zu hören – leider oft mit einem ebenso ernüchternden Klang.
Hallo!
Meine Erzählung stammt aus einer geburtshilflichen Klinik mit angeschlossenem Level-1-Zentrum – hier finden jährlich etwa 2200 Geburten statt. Seit Monaten arbeiten wir – inzwischen sogar geplant – mit Personalmangel. Laut Stellenplan sind acht Positionen unbesetzt. Mein Überstundenkonto weist aktuell 969 Stunden auf.
Hier nun meine Erfahrung von einem Frühdienst im Kreißsaal:Es ist Sonntagmorgen, 5:40 Uhr, und ich mache mich auf den Weg zum Kreißsaal, es ist bereits mein zehnter Dienst in Folge. Ich hoffe inständig auf einen etwas ruhigeren Dienst, da ich erst gestern Abend um 21:30 Uhr die Klinik verlassen konnte. Schon im Eingangsbereich begegnen mir zwei Frauen mit Wehen, die ich am Vorabend aufgenommen hatte. Ein Kaffee wäre jetzt dringend nötig, bevor der Dienst beginnt – denn auch heute sind wir unterbesetzt. Zwei Hebammen betreuen den gesamten Kreißsaal und den Ambulanzbereich. Mit einem mulmigen Gefühl
gehe ich zur Umkleide und werfe einen Blick auf die Kreißsaal-Tafel: Alle fünf Kreißsäle und beide Wehenzimmer sind belegt. Zusätzlich stehen noch zwei weitere Namen im Flur. Kopfschüttelnd ziehe ich mich schnell um.
Eine 1:1-Betreuung gleicht heute einem Sechser im Lotto. Dieser Gedanke macht mich gleichermaßen traurig und wütend. Eine Kollegin aus dem Nachtdienst betritt die Umkleide und bittet mich, rasch eine Geburt zu übernehmen, da sie nach ihrem zehnstündigen Dienst noch Dokumentationsarbeiten erledigen muss. Plötzlich höre ich einen lauten Schrei aus dem Kreißsaal. Mit einigen Eckdaten eile ich zu Kreißsaal 1 und versuche, mir das Chaos draußen nicht anmerken zu lassen. Während ich die zentrale CTG-Überwachung aller Gebärenden im Blick habe, leite ich die Frau zum Pressen an.
Parallel schwirren viele Gedanken durch meinen Kopf. Die Herztöne des Kindes sind zu niedrig. Ich bemühe mich, Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. Gemeinsam mit den Ärzten entscheiden wir uns aufgrund des auffälligen CTGs für eine Saugglockengeburt. Normalerweise sind bei einer vaginaloperativen Entbindung immer zwei Hebammen anwesend – heute ist das leider nicht möglich. Im Hintergrund höre ich wiederholt das Klingeln der Kreißsaaltür. Ein schlechtes Gewissen plagt mich gegenüber meiner Kollegin. Mutter und Kind sind wohlauf. Kurz durchatmen, dann weiter zur Morgenübergabe; parallel warte ich auf die Plazentageburt und notiere mir kurz: Blutzuckerkontrolle Kind KRS 1! Zusammen mit meiner Kollegin teilen wir uns nun sieben Gebärende sowie zwei Patientinnen für die stationäre Aufnahme auf.
Ich betreue die frisch entbundene Patientin aus Kreißsaal 1 sowie eine Zwillingsmutter aus Kreißsaal 4, Wehenzimmer 2 eine werdende Mutter nach Kaiserschnitt mit Blasensprung
und eine Frau mit beginnender Wehentätigkeit. Ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen: KRS 1 wartet noch auf die Plazenta plus Blutzuckerkontrolle beim Kind; KRS 4 hat Frühgeborene Zwillinge bei einer Muttermundöffnung von 5 cm; Wehenzimmer 2 beherbergt eine Zweitgebärende mit Blasensprung unter Antibiotikatherapie und anstehender Geburtseinleitung; außerdem ist noch eine Erstgebärende in der frühen Eröffnungsphase unterwegs. Verzweifelt überlege ich, wo ich diese Erstgebärende unterbringen kann.
Ich hoffe, sie in KRS 1 einplanen zu können – dort fehlt übrigens immer noch die Plazenta. Schnell checke ich alles durch, bis sich die Familie aus Wehenzimmer 2 meldet: Der Ehemann steht erschrocken vor mir, seine Frau musste sich mehrfach übergeben und hat krampfartige Schmerzen. Beruhigend erkläre ich ihm, dass die Wehentätigkeit eingesetzt hat und er sich keine Sorgen machen muss. Mit einer Nierenschale in der einen Hand und dem Telefon in der anderen organisiere ich auf dem Weg zum Schmutzraum ein Bett auf Station. Auf dem Weg zurück beantworte ich das Klingeln aus KRS 1 und informiere den Kreißsaalarzt über den Zustand aus Wehenzimmer 2. Dort entfällt somit die Geburtseinleitung, doch braucht auch sie bald einen Platz im Kreißsaal.
KRS 1 meldet sich: Das Kind möchte gestillt werden. Lächelnd betrete ich den Raum und sage an der Tür: »Ich bin in fünf Minuten für Sie da.« Nachdem ich kurz bei der Zwillingsmutter nach dem Rechten gesehen habe, versorge ich Kreißsaal 1 zu Ende.
Nun ist es bereits 8:30 Uhr, bisher wurde nur ein Kind geboren – dokumentiert wurde noch nichts. Ich eile zurück zu KRS 1, um Mutter und Kind zu kontrollieren und hoffe auf ein gutes Ergebnis beim Blutzuckertest. Die erste Patientin der Kreißsaal-Ambulanz steht bereits vor der Tür. Im gleichen Tempo neigt sich auch der restliche Dienst dem Ende zu: Fünf gesunde Kinder wurden geboren.
Fix und erschöpft nehme ich mein vorbereitetes Frühstück aus dem Kühlschrank mit nach Hause. Am Abend kreisen immer noch Gedanken in meinem Kopf … Habe ich wirklich an alles gedacht? Habe ich alles sorgfältig notiert? Waren die werdenden Familien zufrieden? Ich hoffe inständig, nichts übersehen zu haben. Es macht mich fassungslos, wohin sich die Geburtshilfe entwickelt! Der Tag der Geburt sollte ein unvergessliches Erlebnis sein – kein Fließbandjob!
Sind das bloß vereinzelte Vorfälle? Unglückliche Ausnahmefälle, die einfach mal passieren? Ganz und gar nicht – hinter diesen Zahlen verbergen sich echte Geschichten. Und die Fakten sprechen eine klare Sprache: Über die Hälfte (55 Prozent) der befragten angestellten Hebammen berichtet, dass sich die Zahl der zu betreuenden Frauen in den vergangenen drei Jahren erheblich gesteigert hat. Die Arbeitsbelastung wird von der Mehrheit als enorm empfunden: Mehr als die Hälfte (57 Prozent) gibt an, aufgrund von Personalmangel häufig für Kolleginnen einspringen zu müssen. Ganze 89 Prozent schaffen es kaum oder nur gelegentlich, vorgeschriebene Pausen einzuhalten. Über die Hälfte (55 Prozent) erklärte, dass sie im Jahr 2018 während Schichtdiensten mit besonders hoher Auslastung – also in Zeiten, in denen »viel los ist«, was regelmäßig vorkommt – gleichzeitig vier Frauen im Kreißsaal betreut haben, und 12 Prozent sogar drei Frauen parallel.
Man hört viel vom Pflegenotstand, doch der Hebammennotstand ist mindestens genauso alarmierend. Aktuell fehlen in den Kliniken rund 2000 Hebammen. Das bedeutet, dass 2000 Stellen unbesetzt bleiben. Dabei geht es nicht einmal darum, dass das Geld für diese Stellen fehlt – im Gegenteil! Das eigentliche Problem ist, dass sich schlichtweg niemand auf diese Jobs bewirbt. Es gibt einfach keine Bewerber mehr. Ähnlich wie in der Pflege ist der Arbeitsmarkt nach Jahren katastrophaler Bedingungen völlig ausgetrocknet.
»Ich liebe diesen Beruf, es ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, aber unter den Bedingungen, die wir heute haben, will ich ihn nicht machen«, sagt Katja V., Hebamme seit 35 Jahren und davon 25 Jahre mit eigener Praxis. Manche Dinge sind heute besser geworden – CTG, Ultraschall und Einmalhandschuhe gehören selbstverständlich zum Standard. Doch leider gehört mittlerweile auch dazu: Personalmangel, Druck und Stress ohne Ende, keine Zeit für irgendwen oder irgendetwas. Ein wunderschöner Beruf wurde innerhalb weniger Jahre so zermürbt, dass kaum noch jemand ihn ausüben möchte.
Es ist die klassische Abwärtsspirale.
Je knapper das Personal wird, desto schlimmer wird die Lage: Weil ständig Einspringdienste und Überstunden anfallen, kommt man aus den Schichten selten pünktlich raus – oft ohne auch nur eine Pause zu bekommen, die diesen Namen verdient. Weder zum Frühstück noch zum Mittagessen und manchmal nicht einmal zum Toilettengang. Man rackert sich in Diensten ab, in denen man für zwei arbeitet und trotzdem überall Mangel herrscht. Man hetzt von einer Aufgabe zur nächsten, schafft es kaum jemandem gerecht zu werden, fängt Babys im Akkord auf, begleitet aber kaum noch Geburten wirklich intensiv. Das ist purer Wahnsinn! Über Burnout- und Krankschreibungsraten brauchen wir gar nicht erst zu sprechen – das ist überall dasselbe Bild.
Die Bezahlung verbessert die Situation keineswegs: Um eine Familie zu ernähren, braucht es für Hebammen mindestens eine Vollzeitstelle – doch unter den aktuellen Bedingungen ist eine solche kaum realisierbar und schon gar nicht mit kleinen Kindern vereinbar. Deshalb halten viele diesen Job nicht lange durch. Und diejenigen mit Teilzeitstellen steigen aus, weil sie sagen: Auf dem Papier mag das Teilzeit sein, tatsächlich aber arbeitet man Vollzeit – ständig klingelt morgens um halb sechs das Telefon mit der Frage: »Kannst du zum Frühdienst einspringen?« Da wundert sich niemand mehr, wenn Hebammen lieber Milch im Café aufschäumen – dort gibt es am Ende das gleiche Gehalt bei geregelten Arbeitszeiten und weniger Stress sowie Verantwortung.
Dieses Problem kennen wir von Pflegekräften aller Art – Altenpflegerinnen ebenso wie Kinderkrankenschwestern –, ja sogar Ärzte leiden darunter. Alle Gruppen kämpfen mit zu viel Arbeit und einer viel zu hohen Patientenzahl bei gleichzeitig viel zu wenigen Fachkräften. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den Patientenkontakt zu verkürzen. Alles muss ständig schnell erledigt werden – was natürlich das Risiko erhöht, etwas zu übersehen oder Fehler zu machen. Diese Angst begleitet eigentlich jeden von uns ständig – besonders aber die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Hinzu kommt ein zusätzlicher Druck von oben: Ober- und Chefärzte haben ihre straffen Zeitpläne mit klaren Vorgaben. Niemand möchte derjenige sein, der diese nicht einhält oder zur Übergabezeit gestehen muss, dass noch Patienten unbehandelt in der Ambulanz warten. Das führt zu Ärger von oben. So herrscht ständiger Druck gepaart mit der Angst vor Fehlern. All dies könnte durch mehr Personal ausgeglichen werden.
Stattdessen häufen sich Überstunden an – die weder finanziell noch durch Freizeit kompensiert werden. Überstunden gelten mittlerweile als selbstverständlich; viele Assistenzärzte wehren sich inzwischen offiziell dagegen – bisher ohne Erfolg. Deshalb habe ich selbst den Schritt in die eigene Praxis gewagt – auch wegen all dieser Probleme.
Damit stehe ich nicht allein da: Mehr als die Hälfte der Hebammen denkt darüber nach aufzuhören. Und was mindestens genauso dramatisch ist: Kaum jemand erwägt noch eine Ausbildung in diesem Beruf zu beginnen. Wir leiden unter massivem Nachwuchsmangel. Die Akademisierung wird daran vermutlich wenig ändern. Was damit gemeint ist: Anfang 2020 trat eine Reform der Hebammenausbildung in Kraft. Der Beruf wurde akademisiert – ausgebildet wird nun nicht mehr an einer Fachschule, sondern im Studium. Eine Aufwertung des Berufs zweifellos – aber auch eine Herausforderung: Statt drei Jahren dauert es jetzt vier Jahre bis zum Abschluss und die Anforderungen an Bewerberinnen sind gestiegen.