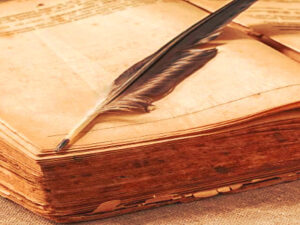Abkehr von der Fläche: In welchem Maße sich die Bahn zunehmend von den ländlichen Gebieten entfernt

Obwohl rund 90 Prozent aller Bahnreisen im Personennahverkehr stattfinden – auf Strecken unter 50 Kilometern oder mit Fahrzeiten unter einer Stunde – fließen lediglich zehn Prozent der Investitionen in diesen Bereich. Im Gegensatz dazu werden neun von zehn Euro in den Ausbau des Personenfernverkehrs investiert, obwohl dort das Passagieraufkommen nahezu stagniert. Auch die Umsetzung einer Hub-and-Spokes-Strategie, bei der nur einzelne Hauptstrecken schneller gemacht werden, hat sich als wenig wirksam erwiesen. Die auf Hochgeschwindigkeitsstrecken gewonnene Zeit geht häufig an Knotenpunkten durch schlechte Nahverkehrsanbindung wieder verloren.
Strukturelle Stärken Deutschlands ungenutzt
Deutschlands polyzentrische Siedlungsstruktur bietet ideale Voraussetzungen für ein dichtes, flächendeckendes Schienennetz, das viele Nutzergruppen anspricht. Doch die Abkehr von der Flächenbahn führt zu einer Fokussierung auf eine schmale Zielgruppe: Geschäftsreisende, die Wert auf Komfort und exklusive Dienstleistungen legen. Seit den 1990er Jahren hat sich die Deutsche Bahn weitgehend vom Anspruch verabschiedet, Bahnreisen für jedermann zugänglich zu machen, und setzt stattdessen auf schnelle Fernverbindungen für wenige.
Rückzug aus dem Flächenverkehr und Folgen für den Gütertransport
Nicht nur der Personen-, sondern auch der Güterverkehr leidet unter dieser Entwicklung. Trotz politischer Versprechen, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, ist die Zahl der industriellen Gleisanschlüsse seit den 1990er Jahren um mehr als zwei Drittel gesunken. Ein zentrales Nadelöhr bleibt die Rheintalstrecke, Deutschlands wichtigste Frachtverbindung zwischen Nordsee und Mittelmeer, die weiterhin mit nur zwei statt vier Gleisen auskommen muss. Investitionsstaus bestehen fort, da Mittel in prestigeträchtige Großprojekte wie neue Bahnhöfe oder ICE-Trassen fließen, während Engpässe im Güterverkehr bestehen bleiben.
Kapitalmarktorientierung und Infrastrukturverschleiß
Die kapitalmarktorientierte Sparpolitik der vergangenen Jahre hat zu einem spürbaren Verschleiß der Gleisanlagen geführt. Immer mehr Strecken können nicht mehr mit der vorgesehenen Geschwindigkeit befahren werden. Gleichzeitig wurde das Schienennetz in den letzten zwei Jahrzehnten kaum erweitert, während das Verkehrsaufkommen weiter steigt. Das Resultat sind überlastete Hauptstrecken und eine zunehmende Unzuverlässigkeit im Bahnverkehr.
Europäische Herausforderungen und notwendige Weichenstellungen
Mit der EU-Osterweiterung stehen dem deutschen Schienennetz neue Herausforderungen bevor: Interoperabilität und ein grenzüberschreitend leistungsfähiges Netz werden immer wichtiger. Nur mit klar definierten Angebotsqualitäten und Mindeststandards kann die Wirtschaft überzeugt werden. Industriegleisanschlüsse und die gezielte Ansiedlung von Unternehmen mit hohem Transportaufkommen in Bereichen mit guter Schienenanbindung wären sinnvolle Maßnahmen. Ebenso sollten öffentliche Transportaufträge bevorzugt an Bahnunternehmen vergeben werden.
Vorbild Schweiz: Angebot schafft Nachfrage
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zeigen, wie eine moderne, leistungsfähige Bahnpolitik aussehen kann. Das Prinzip „Angebot schafft Nachfrage“ wird dort konsequent umgesetzt: Durch Modernisierung der Züge, kontinuierliche Instandhaltung, Beseitigung von Engpässen und eine intelligente Verknüpfung aller Verkehrssysteme erreicht die Schweiz europaweit die höchste Auslastung – und trotzdem sind 95 Prozent der Züge pünktlich. Auch in Deutschland wäre dies möglich, wenn Wartungsintervalle verkürzt, Gleisanlagen regelmäßig saniert und der Güter- vom Personenverkehr getrennt würde.
Politische Verantwortung und Gemeinwohlorientierung
Nach wie vor ist die Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin der Deutschen Bahn durch das Grundgesetz dem Gemeinwohl verpflichtet. Doch auch mehr als zwei Jahrzehnte nach der Bahnreform fehlen Bundesgesetze, die Mindestverkehrsangebote für alle Regionen garantieren. Es ist höchste Zeit, das politische Bekenntnis „Mehr Verkehr auf die Schiene“ mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen – etwa durch eine Orientierung an Art. 87e Abs. 4 GG, der Investitionen in die Schiene als öffentliche Aufgabe hervorhebt.
Für eine zukunftsfähige Bahnpolitik
Ein modernes Industrieland braucht eine leistungsfähige Bahn, die nicht nur auf kurzfristige Gewinne und prestigeträchtige Großprojekte setzt, sondern auf intelligente Vernetzung, enge Taktung und einen Ausbau auch im ländlichen Raum. Verkehrswege sind die Lebensadern der Gesellschaft – es ist Aufgabe des Staates, überall, auch in strukturschwachen Regionen, verlässlichen Bahnverkehr zu gewährleisten. Das Beispiel der Schweiz zeigt: Mit dem richtigen politischen Willen kann die Bahn zu einem Rückgrat nachhaltiger Mobilität werden – und das Gemeinwohl steht dabei an erster Stelle.