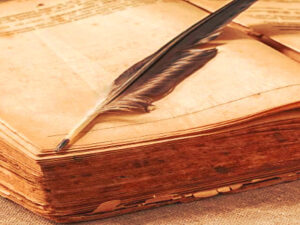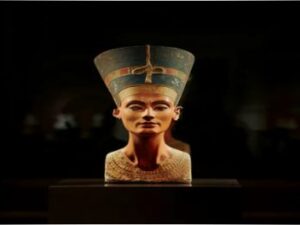Woher stammt der Fortschritt?

In den frühen siebziger Jahren entwickelte der britische Forscher Thomas McKeown eine Theorie, die die öffentlichen Debatten über das Thema Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung für viele Jahre prägen sollte. McKeown beschäftigte sich intensiv mit historischen Veränderungen der Lebenserwartung und untersuchte hierzu umfangreiche Daten aus Großbritannien. Dabei fiel ihm auf, dass es nach den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts zu einem außergewöhnlichen Anstieg der Lebenserwartung gekommen war. Dieser Anstieg stellte eine beispiellose Verbesserung im historischen Verlauf dar, die so bislang nicht beobachtet worden war. Wie viele Wissenschaftler seiner Zeit war auch McKeown daran interessiert herauszufinden, was diesen bemerkenswerten Trend ausgelöst hatte und welche Faktoren für diese Entwicklung verantwortlich waren.
Die Suche nach Ursachen: Medizin, Wohlstand und das Rätsel des Fortschritts
Zunächst lag es für viele Beobachter nahe, die Ursache für den Anstieg der Lebenserwartung in den Fortschritten der Medizin zu sehen. Neue medizinische Entdeckungen, Impfungen und Behandlungsmethoden schienen der naheliegende Grund für die verbesserte Gesundheit der Bevölkerung zu sein. Doch McKeowns detaillierte Analyse lieferte dafür kaum überzeugende Belege. Vielmehr fand er Hinweise darauf, dass die Verbesserung der Lebensumstände mit dem wirtschaftlichen Wandel in Zusammenhang stand. Die Industrielle Revolution brachte eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts mit sich, das Durchschnittseinkommen wuchs und der daraus resultierende Wohlstand schien das zentrale Moment zu sein, das die Lebensverhältnisse vieler Menschen nachhaltig verbesserte. Auf dieser Grundlage entwickelte McKeown seine Hypothese, nach der das Wirtschaftswachstum und die Verbesserung des Lebensstandards die entscheidenden Triebfedern für eine gestiegene Lebenserwartung darstellten.
Der Widerhall in der internationalen Forschung: Preston-Kurve und Ideologie des Wachstums
Diese Sichtweise stand im Gegensatz zu vielen bisherigen Annahmen und stieß deshalb auf großes Interesse. Zur gleichen Zeit präsentierte der amerikanische Demograf Samuel Preston eine Beobachtung, die die These McKeowns zu unterstützen schien. Die sogenannte Preston-Kurve zeigte, dass Länder mit einem höheren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Allgemeinen auch eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung aufwiesen. Dies führte zu einer weit verbreiteten Überzeugung, dass Wirtschaftswachstum unmittelbar mit dem Wohlergehen der Gesellschaft und der Gesundheit der Bevölkerung zusammenhängt. In einer Zeit, in der sich die Ideologie des Wirtschaftswachstums im Zuge des Kalten Krieges durchzusetzen begann, wurden diese Argumente gezielt genutzt, um politische und wirtschaftliche Strategien zu rechtfertigen. Der Kapitalismus wurde als Garant für Fortschritt und Entwicklung propagiert, und internationale Institutionen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds nahmen diese Sichtweise bereitwillig auf.
Weltweite Auswirkungen auf Gesundheitspolitik und wirtschaftliche Strategien
In der Folge wurden Staaten im globalen Süden immer wieder darauf hingewiesen, dass sie zur Verbesserung sozialer Indikatoren wie Lebenserwartung und Kindersterblichkeit weniger auf den Ausbau öffentlicher Gesundheitssysteme setzen sollten, sondern vorrangig auf Wirtschaftswachstum. Die Empfehlung lautete, sämtliche Maßnahmen zur Förderung des Wachstums zu ergreifen – selbst wenn dies bedeutete, Umweltschutz zu vernachlässigen, Arbeitsrechte einzuschränken oder soziale Ausgaben zu kürzen. Die Hoffnung bestand darin, dass Wohlstand letztlich von selbst für eine bessere Lebensqualität sorgen würde. Diese Haltung prägte die internationalen Beziehungen und beeinflusste maßgeblich die Entwicklungspolitik, insbesondere während der achtziger und neunziger Jahre. Strukturanpassungsprogramme wurden als Allheilmittel propagiert, obwohl sie in vielen Ländern zu massiven sozialen Problemen führten.
Revision der Wachstums-These: Historische Perspektiven und Kritik
Mit der Zeit kamen jedoch Zweifel an der Richtigkeit dieser Annahmen auf. Neue Forschungen zeigten, dass McKeown bei seiner Analyse der Lebenserwartung keine langfristigen historischen Daten einbezogen hatte. Betrachtet man die Entwicklung des Kapitalismus seit dem fünfzehnten Jahrhundert, wird deutlich, dass die Expansion kapitalistischer Strukturen oft zu sozialer Entwurzelung, Armut und sogar zu einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse führte. Enclosure-Bewegungen in Europa, Kolonialisierung, Sklavenhandel und Hungersnöte hatten gravierende Auswirkungen auf Gesundheit und Lebenserwartung. Über Jahrhunderte hinweg blieb der Lebensstandard für breite Bevölkerungsschichten niedrig, während nur wenige von den Wachstumsgewinnen profitierten.
Die Bedeutung öffentlicher Güter: Sanitäre Maßnahmen als Wendepunkt
Die Wende kam erst, als im neunzehnten Jahrhundert einfache, aber wirkungsvolle sanitäre Maßnahmen eingeführt wurden. Die Trennung von Abwasser und Trinkwasser, der Bau von öffentlichen Wasserleitungen und die Verbesserung der Hygienestandards führten zu einem drastischen Rückgang lebensbedrohlicher Krankheiten. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen war es jedoch notwendig, öffentliche Mittel zu mobilisieren, private Interessen einzuschränken und den Staat als Akteur im Gesundheitswesen zu etablieren. Jahrzehntelanger Widerstand von Grundbesitzern und Unternehmern wurde erst überwunden, als breite Bevölkerungsschichten politische Mitbestimmungsrechte erhielten. Mit der Ausweitung des Wahlrechts und der Gründung von Gewerkschaften gelang es, den Staat stärker in die Verantwortung zu nehmen und öffentliche Güter für alle bereitzustellen.
Gesellschaftlicher Wandel durch politische Bewegungen und staatliches Engagement
Im weiteren Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts ermöglichte dieser gesellschaftliche Wandel die Einführung weiterer öffentlicher Leistungen wie Gesundheitsversorgung, Impfprogramme, kostenlose Bildung, sozialen Wohnungsbau und sichere Arbeitsbedingungen. Diese Maßnahmen gingen über die bloße Sicherstellung von Überleben hinaus und führten zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität. Neue Forschungsergebnisse, unter anderem von Simon Szreter, haben gezeigt, dass der Zugang zu solchen öffentlichen Gütern maßgeblich zur Steigerung der Lebenserwartung beigetragen hat. Die Wirkung dieser Interventionen wurde in zahlreichen Ländern und über verschiedene Zeiträume hinweg bestätigt, sodass mittlerweile ein breiter Konsens über ihre Bedeutung besteht.
Bedeutung von Bildung und Gesundheitsversorgung für das Wohl der Bevölkerung
Mit der zunehmenden Umsetzung sanitären Maßnahmen und dem Ausbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung wurde deutlich, wie eng gesellschaftliches Wohlergehen mit dem Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung verknüpft ist. Insbesondere Bildung, und hier vor allem Bildung für Frauen, erwies sich als starker Treiber für eine weitere Verbesserung der Lebenserwartung. Je besser Menschen ausgebildet waren, desto bewusster und gesünder lebten sie, was sich in einer erhöhten durchschnittlichen Lebensdauer widerspiegelte. Ergänzend dazu zeigte sich, dass soziale Programme, Impfkampagnen und die Förderung der Chancengleichheit entscheidend dazu beitrugen, die Lebensverhältnisse breiter Bevölkerungsschichten zu heben.
Kritische Neubewertung des Zusammenhangs zwischen Wachstum und Wohlergehen
Obwohl hohe Einkommen und wirtschaftliches Wachstum generell mit einer gesteigerten Lebenserwartung einhergehen, zeigt die historische Analyse, dass zwischen diesen Faktoren kein unmittelbarer, kausaler Zusammenhang besteht. Die Entfaltung des menschlichen Potenzials hängt vielmehr davon ab, wie Gesellschaften mit ihren Ressourcen umgehen, wie sie Güter verteilen und welche politischen Kräfte das Handeln bestimmen. Fortschritt wurde immer dann erzielt, wenn gesellschaftliche Bewegungen und Regierungen gezielt darauf hingearbeitet haben, öffentliche Güter zu schaffen und faire Arbeitsbedingungen zu sichern. In Phasen, in denen diese Kräfte schwach waren oder fehlten, führte wirtschaftliches Wachstum nicht zu einem besseren Leben, sondern verschärfte häufig soziale Ungleichheit.
Gesellschaftliche Prioritäten und nachhaltiger Fortschritt
Die umfassende Betrachtung der historischen Entwicklungen legt nahe, dass die Verbesserung von Gesundheit und Lebenserwartung weniger durch reines Wirtschaftswachstum, sondern vielmehr durch gezielte Investitionen in öffentliche Infrastruktur, Bildung und soziale Gerechtigkeit erreicht wurde. Es ist die Aufgabe von Gesellschaft und Politik, das durch Wachstum geschaffene Potenzial so zu nutzen, dass es der gesamten Bevölkerung zu Gute kommt. Nur so kann langfristig ein nachhaltiger Fortschritt erzielt werden, der nicht allein auf ökonomischen Kennzahlen beruht, sondern auf einer echten Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle.