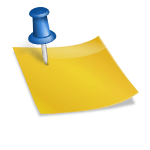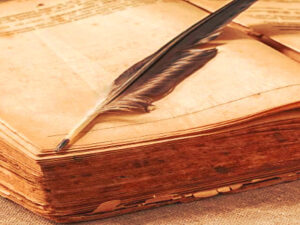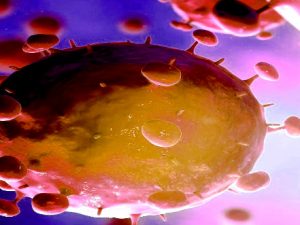Vom individuellen Druck zur gesellschaftlichen Besessenheit

Eine gründliche Analyse der inneren Mechanismen und Dynamiken des Kapitals kann den anhaltenden Wachstumsdruck in der Wirtschaft zwar nur bedingt erklären. Es ist jedoch unabdingbar, das Verhalten der Regierungen in den Blick zu nehmen, um ein umfassenderes Verständnis für die Ursachen und die Verstärkung dieses Drucks zu gewinnen. Historisch gesehen waren Regierungen stets eng in die Förderung der Interessen der kapitalistischen Expansion eingebunden. Sie haben aktiv Maßnahmen ergriffen, um die kapitalistische Wirtschaftsordnung voranzutreiben und zu stärken. So wurden beispielsweise die Enclosure-Bewegung in Europa und die Kolonialisierung in Übersee letztlich durch staatliche Macht legitimiert und institutionalisiert. Seit den frühen 1930er-Jahren, in der Zeit der großen Weltwirtschaftskrise, lässt sich jedoch eine Entwicklung feststellen, die diesen Druck zusätzlich verstärkte und die Dynamik des Kapitalismus noch einmal deutlich beschleunigte.
Die Große Depression und die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
Die Weltwirtschaftskrise, die Anfang der 1930er Jahre ihren Anfang nahm, führte zu einer massiven Zerstörung der Volkswirtschaften in den Vereinigten Staaten, in Westeuropa und in vielen anderen Teilen der Welt. Diese Krise zwang die Regierungen dazu, dringend nach Lösungen zu suchen, um die wirtschaftlichen Schäden zu beheben. In den USA wandten sich Regierungsvertreter an Simon Kuznets, einen jungen und innovativen Ökonomen aus Weißrussland, und baten ihn, ein System zu entwickeln, das die Produktion aller Güter und Dienstleistungen, die jährlich in den USA hergestellt wurden, erfasst. Ziel war es, durch ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen Abläufe Probleme zu identifizieren und gezielt eingreifen zu können.
Kuznets entwickelte daraufhin eine Kennzahl, die sogenannte „Bruttosozialprodukt“ (BSP), die später die Grundlage für den heute bekannten Begriff des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bildete. Kuznets selbst warnte jedoch ausdrücklich vor den Grenzen und Mängeln dieses Indikators. Er machte deutlich, dass das BIP den Marktwert aller wirtschaftlichen Aktivitäten zusammenzählt, ohne zu unterscheiden, ob diese Aktivitäten nützlich oder schädlich sind. Es macht keinen Unterschied, ob ein Wert von 100 Dollar für Teergas oder für Bildung ausgegeben wird. Noch entscheidender ist, dass das BIP keinerlei Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Kosten der Produktion findet. Wenn beispielsweise durch das Abholzen eines Waldes Holz gewonnen wird, steigt das BIP – ebenso wie bei verlängerten Arbeitszeiten, verschobenem Rentenalter oder Umweltverschmutzung, die zu mehr Krankenhausaufenthalten führt. Das BIP sagt jedoch nichts darüber aus, was der Verlust an natürlichen Lebensräumen, die Zerstörung des Ökosystems oder die Belastungen des menschlichen Körpers und Geistes durch Überarbeitung und Umweltverschmutzung bedeuten.
Die Grenzen des BIP als Wohlstandsindikator
Das BIP ist somit eine äußerst eingeschränkte Kennzahl, die keine Auskunft über die tatsächlichen Belastungen und die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Aktivitäten gibt. Es erfasst keine negativen Folgen wie Umweltzerstörung, soziale Ungleichheiten oder gesundheitliche Schäden, die durch die Produktion entstehen. Gleichzeitig ignoriert es viele positive Aspekte, die nicht in Geld messbar sind, aber für das menschliche Wohlbefinden von zentraler Bedeutung sind. Tätigkeiten wie die Selbstversorgung mit Lebensmitteln, die Pflege älterer Angehöriger, Hausarbeit oder die Unterstützung im Freundes- und Familienkreis bleiben außen vor, wenn sie nicht durch bezahlte Dienstleistungen ersetzt werden. Nur wenn jemand für diese Tätigkeiten eine Firma beauftragt, fließen sie in das BIP ein. Kuznets warnte zu Recht davor, das BIP als alleinigen Maßstab für den wirtschaftlichen Fortschritt zu verwenden. Er plädierte dafür, dieses System zu verbessern und soziale sowie ökologische Kosten stärker zu berücksichtigen, damit Regierungen eine ganzheitliche und menschlich orientierte Sichtweise entwickeln können.
Der Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Messung von Wachstum
Doch all diese Überlegungen traten in den Hintergrund, als der Zweite Weltkrieg auszubrechen drohte. Die nationale Sicherheit und das Überleben der Staaten waren nun die vordringlichsten Anliegen. Die weltweiten Bedrohungen durch die Nationalsozialisten, Japan und andere Achsenmächte erforderten eine Mobilisierung aller Ressourcen. In diesem Kontext wurde die Idee, alle wirtschaftlichen Aktivitäten – inklusive der negativen – zu erfassen, um die verfügbaren Produktionskapazitäten und Finanzmittel für die Kriegsanstrengungen zu nutzen, zunehmend Realität. Diese aggressive Sichtweise auf das Bruttosozialprodukt wurde nach dem Krieg maßgeblich durchgesetzt.
Bei der internationalen Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944, bei der führende Politikerinnen und Politiker aus aller Welt zusammenkamen, um die Regeln für die globale Wirtschaft nach dem Krieg festzulegen, wurde das BIP als zentraler Indikator für den wirtschaftlichen Fortschritt eingeführt. Diese Entscheidung widersprach den ursprünglichen Warnungen von Kuznets, der die Grenzen des BIP deutlich gemacht hatte. Doch das Wachstum des BIP wurde seither zum wichtigsten Ziel der nationalen Wirtschaftsplanung – unabhängig davon, ob es tatsächlich das menschliche Wohlergehen verbessert oder ökologische und soziale Belastungen in Kauf nimmt.
Wachstum als Selbstzweck und die Folgen für die Gesellschaft
Grundsätzlich ist es nicht problematisch, einige Aspekte der Wirtschaft zu messen, um den Zustand der Volkswirtschaft zu beurteilen. Das BIP selbst beeinflusst die reale Welt allerdings in zweierlei Hinsicht: Einerseits hat es keinen direkten Einfluss, andererseits kann das Wachstum des BIP sehr wohl weitreichende Auswirkungen haben. Sobald der Fokus auf dem Wachstum liegt, wird nicht nur die Produktion gesteigert, sondern auch jene Aktivitäten, die im BIP erfasst werden. Dies geschieht ohne Rücksicht auf die damit verbundenen Kosten, seien sie sozialer oder ökologischer Natur. Die ursprüngliche Funktion des BIP war es, das Niveau der Wirtschaftsleistung zu messen – also ob dieses Niveau zu hoch war und Überproduktion oder Überangebot drohten, oder ob es zu niedrig war und die Bevölkerung nicht ausreichend versorgt wurde.
Während der Weltwirtschaftskrise war klar, dass die Produktion zu gering war, weshalb westliche Regierungen massiv in Infrastrukturprojekte investierten, Arbeitsplätze schufen und die Nachfrage anregten. Ziel war es, das BIP zu erhöhen, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Diese Maßnahmen entsprachen der sogenannten „progressiven Ära“ unter Präsident Franklin D. Roosevelt. Damals galt es als erklärtes Ziel, das Niveau der Wirtschaftsleistung gezielt zu steigern, um soziale Verbesserungen und mehr Wohlstand für die Bevölkerung zu erreichen. Das Wachstum wurde also als Mittel zum Zweck verstanden, um die Lebensqualität zu erhöhen.
Vom Wachstumsziel zum Wachstum als Selbstzweck
Diese Perspektive hielt jedoch nur eine gewisse Zeit. Mit der Gründung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Jahr 1960 änderte sich die Haltung grundlegend. Es ging nicht mehr darum, durch gezielte Maßnahmen das Niveau der Wirtschaftsleistung zu verbessern, um soziale und humanitäre Ziele zu erreichen. Stattdessen wurde das sogenannte „optimale Wachstum“ zum Ziel der Wirtschaftsplanung erklärt – also ein Wachstum, das keine Grenzen kennt und unbegrenzt fortgesetzt werden soll. Die britische Regierung setzte sich das ambitionierte Ziel, innerhalb eines Jahrzehnts um 50 Prozent zu wachsen – eine außergewöhnliche Expansionsrate. Damit wurde erstmals in der Geschichte die Idee verbreitet, dass Wachstum an sich ein Ziel sei, das unabhängig von sozialen oder ökologischen Überlegungen verfolgt werden könne.
Der Kalte Krieg und die Wachstumswettkämpfe zwischen Ost und West
Diese Idee wurde rasch international übernommen. Während des Kalten Krieges wurde der Wettstreit zwischen dem Westen und der Sowjetunion vor allem durch die jeweiligen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts ausgetragen. Wer konnte das BIP schneller steigern? Für den Westen war Wachstum nicht nur ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke, sondern auch eine Voraussetzung für eine stärkere Verteidigungskraft und eine bessere Position im geopolitischen Machtkampf. Das schnelle Wachstum wurde somit auch zu einem Instrument der politischen und militärischen Konkurrenz.
Neoliberale Wende und die Entfesselung des Kapitalwachstums
Mit der Zeit änderte sich die Ausrichtung der westlichen Wirtschaftspolitik grundlegend. Die politischen Strategien, die nach der großen Depression auf soziale Verbesserungen, höhere Löhne, Gewerkschaften, Investitionen in Gesundheit und Bildung abzielten, wurden zunehmend infrage gestellt. Stattdessen wurde das Wachstum als Selbstzweck betrachtet, unabhängig von sozialen oder ökologischen Zielen. Die Folge war die sogenannte neoliberale Wende in den 1980er-Jahren, die vor allem von Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien vorangetrieben wurde. Ziel war es, die Profitraten durch Deregulierung, Privatisierungen und Kürzungen im Sozialbereich wiederherzustellen. Diese Politik führte dazu, dass der Staat sich aus der direkten Steuerung der Wirtschaft weitgehend zurückzog und das primäre Ziel darin bestand, günstige Bedingungen für die Kapitalakkumulation zu schaffen. Es wurde immer deutlicher, dass das Wachstum des BIP zum Selbstzweck wurde – ein „Wachstumismus“, der kaum noch soziale oder ökologische Belange berücksichtigt.
Die globale Ausdehnung des Wachstumszwangs in den Süden
Auch im globalen Süden wurde diese Wachstumslogik übernommen. Nach dem Ende der Kolonialzeit in den 1950er-Jahren setzten viele neu unabhängige Staaten auf Strategien, die auf wirtschaftliche Selbstständigkeit und soziale Entwicklung abzielten. Sie nutzten Zölle, Subventionen und Investitionen in Bildung und Gesundheit, um die Lebensstandards zu verbessern und die Abhängigkeit vom Kolonialismus zu überwinden. Das Durchschnittseinkommen in diesen Ländern stieg in den 1960er- und 1970er-Jahren kontinuierlich an, durchschnittlich um etwa 3,2 Prozent pro Jahr, wobei Wachstum stets als Mittel zur Unabhängigkeit und humanen Entwicklung verstanden wurde – ähnlich wie im Westen nach der großen Depression. Doch mit der zunehmenden Dominanz westlicher Interessen geriet diese Entwicklung ins Wanken.
Die Interventionen der internationalen Finanzinstitutionen und die Folgen für den Süden
Die westlichen Mächte, vor allem durch ihre Kontrolle über die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF), griffen während der Schuldenkrise in den 1980er-Jahren massiv in die Wirtschaftsplanung der Entwicklungsländer ein. Sie führten sogenannte „Strukturanpassungsprogramme“ ein, die auf eine Liberalisierung der Wirtschaft, die Abschaffung von Zöllen, die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen und die Privatisierung öffentlicher Unternehmen abzielten. Ziel war es, ausländisches Kapital zu fördern und den Zugang zu billiger Arbeitskraft sowie Rohstoffen wieder zu erleichtern. Diese Programme transformierten die Volkswirtschaften im Süden grundlegend: Sie zwangen die Regierungen, ihre sozialen und humanitären Ziele aufzugeben und stattdessen ausschließlich auf die Anziehung von Kapital und den Export ausgerichtet zu sein.
Die Folgen waren verheerend: In den zwei Jahrzehnten nach Einführung der neoliberalen Strategien kam es zu massiven Krisen, steigender Armut, wachsender Ungleichheit und hoher Arbeitslosigkeit. Die Einkommensniveaus im Süden brachen in dieser Zeit regelrecht ein und sanken im Durchschnitt auf nur noch 0,7 Prozent Wachstum pro Jahr. Währenddessen konnten große multinationale Konzerne von den neuen Bedingungen profitieren: Sie erzielten Rekordgewinne, während die Einkünfte der reichsten Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern stark anzusteigen begannen. Die Wachstumsraten im Westen erholten sich zwar, doch zu hohen Kosten: Das soziale Gefüge, die Lebensbedingungen der Menschen und die Umwelt wurden massiv belastet.
Langfristige Folgen und die wachsende globale Ungleichheit
Das Erbe dieser Interventionen ist eine dramatische Zunahme der globalen Ungleichheit. Die Einkommensschere zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Heute ist die reale Einkommenskluft pro Kopf zwischen diesen beiden Welten etwa viermal so groß wie am Ende der Kolonialzeit. Die Folgen sind tiefgreifend: Es besteht eine wachsende Kluft zwischen den wohlhabenden Ländern und den ärmeren Staaten, die sich in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht auf unterschiedlichste Weisen auswirkt. Die jahrzehntelangen Maßnahmen des Wachstumszwangs im Namen des Kapitals haben die Welt in eine Situation geführt, in der die sozialen, ökologischen und politischen Spannungen immer größer werden – mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität und den Frieden auf globaler Ebene.