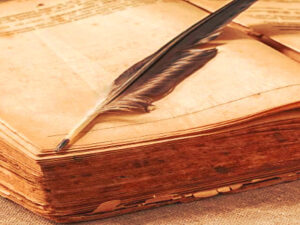Geschichte: Was hat der DDR-Geheimdienst in Schweiz gemacht?
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.comAn einem Septembervormittag im Jahr 1981 befragen zwei Beamte der schweizerischen Bundespolizei in Lugano einen deutschen Unternehmer. Die Bundesanwaltschaft hat gegen den 54-jährigen Mann ein gerichtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Spionage eingeleitet. Der gut gekleidete Herr mit dem amputierten Arm wird vier Stunden lang zu seinen geschäftlichen Verbindungen zur DDR und seinen Kontakten zum Ministerium für Staatssicherheit befragt.
Der Beschuldigte und seine Behauptungen
Der Beschuldigte gibt vor, unwissend zu sein, bestreitet jegliche Beziehungen zur Stasi und versichert, nur legale Geschäfte mit der DDR zu tätigen. Diese Behauptungen sind jedoch schwer zu widerlegen, da es sich bei dem Verdächtigen um Ottokar Hermann handelt, der jahrzehntelang als eine Art Schweizer Vertreter des Ost-Berliner KoKo-Chefs Alexander Schalck-Golodkowski fungierte. Hermann, ein zwielichtiger Geschäftsmann und ehemaliges Mitglied der Waffen-SS, stand über viele Jahre im Fokus des schweizerischen Staatsschutzes, da er in den illegalen Handel mit Technologien im Ostblock verwickelt war, verdeckte Finanz- und Devisengeschäfte für die DDR abwickelte und geheime Konten verwaltete.
Hintergrund und Verwicklungen in den Ost-West-Handel
Durch die Unterstützung eines ehemaligen Stasi-IM wurde das Tessin zu einem der bedeutendsten Außenhandelszentren und Schmuggelrouten der DDR im Westen. Nach der Wende wurde ihm darüber hinaus vorgeworfen, sich in erheblichem Maße an den Vermögenswerten der DDR bereichert zu haben. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe und zahlreicher Indizien konnte dem dubiosen Kaufmann nie endgültig rechtlich das Handwerk gelegt werden. Eine Ausweisung aus der Schweiz drohte Hermann vor seiner Einbürgerung ebenfalls nie.
Hermann: Vom Jugendlichen im Krieg zum internationalen Schmierhandelsprofi
Ottokar Hermann, geboren 1926 in Znaim im Sudetenland, wurde als Jugendlicher zum Militärdienst einberufen. Er war Mitglied der Hitlerjugend und trat im Dezember 1943, im Alter von nur siebzehn Jahren, in die berüchtigte Waffen-SS ein. Als Unterscharführer (Unteroffizier) kämpfte er in der Aufklärungsabteilung der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich“. Diese SS-Panzerdivision war für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich. Angehörige dieser Einheit verübten im Juni 1944 in Oradour-sur-Glane ein Massaker von trauriger Berühmtheit: Soldaten der Waffen-SS töteten dort 642 Menschen, fast alle Einwohner des französischen Dorfes. Ob Hermann in solche oder andere Kriegsverbrechen in Frankreich verwickelt war, ist jedoch nicht bekannt.
Von den Kriegswirren zum Unternehmer im Nachkriegsdeutschland
Im August 1944 befand sich seine Einheit auf dem Rückzug von der Westfront, als das Unglück geschah: Ein Granatsplitter verletzte Hermann so schwer, dass er seinen linken Arm verlor. Er wurde ins Reservelazarett Fritzlar bei Kassel gebracht. Nach dem Krieg geriet er in Österreich in amerikanische Gefangenschaft, aus der er im Februar 1946 entlassen wurde. Den Amerikanern hatte Hermann als Dolmetscher gedient. Nach dem Krieg ließ er sich in München nieder, wo er zunächst bei BMW und später beim Lokomotiven- und Panzerbauer Krauss-Maffei arbeitete. 1953 zog er nach West-Berlin, eröffnete dort ein Geschäft für Radio- und TV-Geräte. Nach dessen Verkauf stieg er in den innerdeutschen Handel ein. 1962 ließ er sich im Tessin nieder – angeblich auf Anweisung seiner Verbindungsleute aus Ost-Berlin, um von der Schweiz aus die finanziellen Angelegenheiten der DDR zu verwalten.
Das Tessiner Domizil: Wohnsitz mit politischer Bedeutung
In Montagnola bei Lugano bezog er zusammen mit seiner Frau Gerda die „Casa Maroccana“, die einen Panoramablick auf den Luganer See und die piemontesischen Alpen bot. Das moderne Flachdachhaus, das er an bevorzugter Hanglage errichten ließ, wurde zu seinem langjährigen Wohnsitz. Später lebte er in einer prächtigen Villa im italienischen Stil, umgeben von einem dicht bewachsenen Park mit hohen Bäumen. Seinen Wohnsitz in West-Berlin behielt er bis in die Siebzigerjahre.
Das Bild des bürgerlichen Unternehmers im Tessin
Im Hermann-Hesse-Dorf baute Ottokar Hermann, der teilweise als „forscher Draufgänger“ beschrieben wurde, eine bürgerliche Existenz auf: Er gab sich als seriöser, wohlhabender und kultivierter Geschäfts- und Ehemann, sammelte Briefmarken, fuhr einen blauen Mercedes 280 und bemühte sich um ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn. Im Dorf war er gut integriert; er war Mitglied des örtlichen Fußballklubs und trat häufig als großzügiger Mäzen auf. So spendete er dem FDP-orchester „Filarmonica Liberale Radicale della Collina d’Oro Gentilino“ in den Achtzigerjahren mindestens eine halbe Million Franken für die Sanierung eines Gebäudes mit Konzertsaal und Restaurant.
Fassade einer harmlosen Wohlhabenden?
Was harmlos klingt, stellte sich als perfekte Fassade heraus: Vom Tessin aus steuerte Ottokar Hermann, der in den Sechzigerjahren als „Rohloff“ in den Untergrund der Stasi eingeweiht wurde, ein internationales Netz von Tarnfirmen der DDR, das speziell zur Beschaffung von Devisen und Hochtechnologie eingerichtet worden war. Im Zentrum dieses Firmengeflechts standen die von Hermann kontrollierten Unternehmen mit Sitz in Lugano. An diesen Gesellschaften hielt Stasi-Oberst und stellvertretender KoKo-Chef Manfred Seidel bedeutende Beteiligungen.
Das komplexe Firmengeflecht in der Schweiz
Die Intrac S.A. sowie deren Tochtergesellschaften in West-Berlin waren direkt an der Beschaffung von Hightech-Geräten und Embargowaren sowie an der Finanzierung solcher Umgehungsgeschäfte beteiligt. Die Befisa und deren Tochterunternehmen wurden zur Generierung von Devisen eingesetzt. Die Gewinne der Befisa-Gruppe flossen auf das sogenannte Mielke-Konto. Die Verwendung dieses Geldes oblag dem Chef des DDR-Staatssicherheitsdienstes, Erich Mielke. Nach seinen Vorgaben wurden die Gelder für Stasi-Operationen sowie die Versorgung der SED-Spitze in Wandlitz genutzt.
Der politische Aufstieg und die Doppelrolle
Ab Mitte der Siebzigerjahre strebte Ottokar Hermann die Erlangung der Schweizer Staatsbürgerschaft an, die ihm 1985 verliehen wurde. Ein Jahr später soll seine Spende von einer halben Million Franken – aufgeteilt in fünf Tranchen – an das FDP-Orchester geflossen sein; sein Rechtsanwalt soll ihn dazu aufgefordert haben. Als Dank wurde Hermann 1991 Ehrenmitglied der Philharmonie. Trotz dieser Anerkennung hielt Spartaco Arigoni, damals Vorsitzender der Philharmonie, einen Zusammenhang mit seiner Einbürgerung für absurd.
Systematische Umgehung des Embargos
Hermann schien ständig bereit zu sein zu spenden: Einem Krankenhaus in Lugano beschaffte er einen Rettungswagen samt hochmoderner Ausstattung; die Schule von Montagnola erhielt großzügige Mittel für ihre Bibliothek. Es wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass er sich mit Geld Freunde erkauft habe.
Die Rolle der Schweiz im Ost-West-Embargo
Die systematische Umgehung des Embargos, das den Westen daran hinderte, Hoch- und Militärtechnologie in den Ostblock zu liefern, gelang der DDR zu einem erheblichen Teil mithilfe von Firmen mit Sitz in der Schweiz. In diesem Kontext spielte Ottokar Hermann eine zentrale Rolle bei der Beschaffung von Hightech-Waren; faktisch agierte er als „Generalvertreter“ der DDR-Außenwirtschaft in der Schweiz. Bereits in den Sechzigerjahren war er als Lieferant von Embargowaren im Dienste der Stasi tätig.
Das Firmengeflecht und die Verstrickungen in der Schweiz
Von seinem Sitz bei Intrac S.A., gegründet 1970 in Lugano, steuerte Hermann ein weit verzweigtes Firmengeflecht in Liechtenstein, Deutschland, West-Berlin und Österreich. Er wurde von den Behörden als skrupelloser Geschäftsmann und „Weißkragenkrimineller“ beschrieben. Er verfügte über hervorragende Verbindungen bis tief in die Ministerien der DDR und soll bereits in den Sechzigerjahren konspirative Kontakte zu späteren DDR-Ministerialbeamten gepflegt haben.
Verdeckte Kontakte und die Akten des Bundesarchivs
Entgegen seinen Aussagen während des Verhörs durch die Bundespolizei im Jahr 1981 hatten Hermann auch beste Kontakte zu hochrangigen Stasi-Mitarbeitern; dies belegen Akten aus dem Schweizer Bundesarchiv. Demnach geriet er in den Sechzigerjahren ins Visier des bundesdeutschen Geheimdienstes, wurde aber 1967 des Spionageverdachts entlastet.
Vertrauen und enge Verbindungen auf höchster Ebene
Hermann genoss nicht nur das Vertrauen von Schalck-Golodkowski; auch stand er in engem Kontakt mit dessen Stellvertreter Manfred Seidel. Dieser hielt sich mehrfach in der Schweiz auf und war offiziell Aktionär bei Befisa S.A. und Intrac S.A. mit erheblichen Anteilen.
Treffpunkte und konspirative Aktivitäten in Lugano
Die Intrac in Lugano war ein wichtiger Treffpunkt: Hier trafen sich Reisekader aus den DDR-Außenhandelsabteilungen sowie Stasi-Offiziere regelmäßig. Auch wenn die schweizerische Bundespolizei über Namen von Stasi-Agenten verfügte, gewährte die Schweiz jahrelang ungehinderten Zugang für ostdeutsche Geschäftspartner, was die Bedeutung des Standorts für den Ost-West-Schmuggel unterstreicht.
Die wirtschaftliche Dimension: Umsätze, Provisionen und Vermögen
Im Jahr 1979 schätzte die schweizerische Bundespolizei den Jahresumsatz von Intrac S.A. auf 400 Millionen Franken. Hermann verdiente bis zu 15 Prozent Provision, sein Vermögen belief sich Ende der Siebzigerjahre auf 4,6 Millionen Franken, dazu kamen Konten mit bis zu 80 Millionen Franken. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Geld treuhänderisch für die DDR oder die Stasi verwaltet wurde.
Der Fall des Mauerfalls und die versteckten Gelder
Nach dem Fall der Mauer wurden auf einem Schweizer Konto in Lugano 50 Millionen DM gefunden; Manfred Seidel hatte hierfür eine Einzelzeichnungsberechtigung. Das Geld wurde für dubiose Devisengeschäfte verwendet, oft ohne Belege, darunter eine Auszahlung von einer Million DM im Mai 1982.
Die Finanzierung der DDR-Operationen durch geheime Kanäle
Die Milliardenbeträge für Embargowaren wurden unter anderem durch die „Kommerzielle Koordinierung“ erwirtschaftet, eine streng geheime Abteilung des Außenhandels, die unter Kontrolle der Stasi stand. An deren Spitze stand Schalck-Golodkowski, der 1989 in den Westen floh. Hermann galt als dessen „Statthalter“ in der Schweiz und war maßgeblicher Akteur beim Schmuggel von Hochtechnologie und Devisen, um die wirtschaftlichen Interessen des Ostens zu sichern.
Das Imperium KoKo: Von Hochtechnologie bis Luxus
Das komplexe KoKo-Imperium umfasste mindestens 160 Handelsgesellschaften und Briefkastenfirmen weltweit. Zu den Objekten des Tessiner Unternehmens Befisa gehörte auch eine Ferienanlage auf Fuerteventura. Die Tentakel dieses Systems reichten tief hinein bis in die Schweiz, sogar bis zu den Alpen, wo KoKo Anteil an Zermatter Standseilbahn Sunnegga hatte.
Ein Netzwerk im Schatten des Kalten Krieges
Ottokar Hermann war eine zentrale Figur im verdeckten Ost-West-Handel, dessen Aktivitäten den Kalten Krieg maßgeblich beeinflussten. Sein Leben und Wirken spiegeln die komplexen Verstrickungen zwischen Geheimdiensten, Wirtschaft und Politik wider – eine Schattenwelt, die bis heute nur ansatzweise aufgeklärt ist.