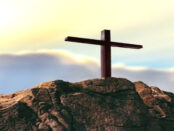Ein Appell für die Gleichwertigkeit von Bankkonto und das Geld unter der Matratze
 Screenshot youtube.com
Screenshot youtube.com
Das Bankgeheimnis, das in den letzten Jahren stark kritisiert und mittlerweile international weitgehend abgeschafft wurde, ist im Wesentlichen nichts anderes als die Gleichstellung von Geld auf einem Bankkonto mit Geld, das zu Hause aufbewahrt wird. Die ökonomische Privatsphäre gegenüber Dritten gilt unabhängig davon, ob eine Person ihr Geld zu Hause oder bei der Bank lagert. Das Bankgeheimnis droht den Bankangestellten mit Strafen, wenn sie unbefugten Dritten Zugang zu den Kontoinformationen ihrer Kunden gewähren. Dies ist vergleichbar mit den Strafen für einen Hausmeister, der Unbefugten Zutritt zu den Wohnungen der Mieter gewährt.
Da das Eindringen in Wohnungen wesentlich komplizierter ist als der Zugriff auf ein Dokument oder einen Computerbildschirm und zudem keine sichtbaren Spuren hinterlässt, war und ist die Versuchung, bei Banken und deren Mitarbeitern nach Informationen zu fragen, besonders groß. Dementsprechend sind die Strafen für Bankmitarbeiter strenger als für den versäumenden Hausmeister. Wird die Gleichheit der Privatsphäre im privaten Haushalt und bei der Bank verletzt, besteht die Gefahr, dass der Staat durch aggressivere Zugriffsrechte auf Bankkonten lediglich bewirkt, dass Bürger nach alternativen Aufbewahrungsmöglichkeiten suchen. Ein solcher Druck führt letztlich nicht zu einer erhöhten Steuerehrlichkeit, sondern dazu, dass Vermögenswerte im privaten Bereich zurückgehalten werden.
Eine solche Entwicklung wäre jedoch volkswirtschaftlich alles andere als vorteilhaft. Die modernen Formen der Geldaufbewahrung sind vielfältig. Sie reichen von Bargeld über Goldbarren, die bereits als Goldtafeln oder Tafelbarren mit vorgefertigten Kerben zum Abbrechen kleiner Stücke angeboten werden, bis hin zu Brillanten, Gemälden und Sammlerobjekten aller Art sowie Immobilien im In- und Ausland, die schlecht genutzt werden. Auch eine Flucht in Steueroasen auf anderen Kontinenten wird von einigen in Betracht gezogen. Doch im Interesse des Gemeinwohls gehört Geld besser auf die Bank als in einen Tresor. Von dort fließt es über Kredite oder Investitionen in Anleihen oder Aktien in den Wirtschaftskreislauf zurück. Damit es auf der Bank bleibt, muss es hinsichtlich Sicherheit vor Verlust und Einblicken mindestens gleich gut geschützt sein wie anderswo. In Bezug auf den Schutz vor Verlust wurde dank des Einlegerschutzes viel erreicht. Vertrauen aufzubauen benötigt jedoch Jahre, manchmal Jahrzehnte. Um dieses Vertrauen zu zerstören, reicht oft schon ein einziger Satz.
Mit dem Vorgehen während der Überschuldungssituation Zyperns im Frühjahr 2013 hat die europäische Politik über Nacht mehr Vertrauen zerstört, als sich in vielen Jahren hätte aufbauen lassen. Selbst Einlagen von Kleinanlegern sollten zur Sanierung des maroden Finanzsystems herangezogen werden – ein Novum in der Geschichte der EU. Nach massiven Protesten auf den Straßen Zyperns einigten sich die politischen Verantwortlichen schließlich darauf, dass Spargelder bis 100 000 Euro von diesen Sanierungsmaßnahmen verschont bleiben sollten. Das Thema, wonach Erspartes über 100 000 Euro zur Rettung maroder Banken verwendet werden kann, ist jedoch im EU-Raum noch nicht vom Tisch.
Es könnte sein, dass es im Rahmen der umstrittenen Europäischen Bankenunion zu einer Angleichung der einzelnen Positionen kommt. Der Anleger darf hoffen, dass sein Erspartes wenigstens in der Schweiz vor solchen Zugriffen geschützt bleibt. Auch die Mehrheit der Sparer in Deutschland und Österreich vertraut weiterhin ihren Banken und geht davon aus, dass es nicht zu einer gesamteuropäischen Einigung in der zuletzt diskutierten Richtung kommen wird. Es stellt sich die Frage, welche Vertraulichkeit dem einzelnen Bürger in finanziellen Angelegenheiten noch garantiert werden kann.
Ohne das Bankgeheimnis ist Geld auf einem Konto hinsichtlich Vertraulichkeit deutlich gefährdeter als wenn es zu Hause oder anderswo gehortet wird. Sofort stellt sich auch die Frage, wie viel Sicherheit ein Schließfach in Zukunft noch bieten kann. Werden die Behörden auch dort bald problemlos Einsicht nehmen können? Oder sollen die Banken diese Aufgabe übernehmen und bei allen Kunden eine Bestandsaufnahme machen sowie ihre Erhebungen auf internationaler Ebene melden? In den Fokus dieser Diskussion rücken auch Lagerhäuser. Letztlich muss die Politik vernünftige Antworten finden, wo Grenzen gezogen werden können, ohne dass der Einzelne in seiner Freiheit eingeschränkt wird und es somit auch zu wirtschaftlichen Fehlentwicklungen kommt. Denn es ist unbestreitbar: Gelder sollten im wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit auf den Konten offizieller Banken verbleiben und nicht aufgrund politischen Drucks und schlechterer Behandlung der Kontoinhaber abfließen.
Im Rahmen dieser Logik sollte jedoch der Sparer, der sein Geld zur Bank bringt, nicht benachteiligt werden im Vergleich zu Personen, die dem gesamten Finanzsystem ohnehin misstrauen und ihre Vermögenswerte entsprechend anderswo lagern. Es wird entschieden für eine Gleichbehandlung plädiert: Der Staat sollte sowohl die physische Welt als auch die virtuelle Welt mit gleich langen Spiessen angehen. Natürlich ist es technisch relativ einfach, E-Mails zu überwachen, Telefongespräche abzuhören und Einblicke in die Bankkonten der Bürger zu erhalten. Doch eine von Vernunft geleitete Gesellschaft sollte solchen Versuchungen nicht erliegen und in diesen Bereichen dieselbe Zurückhaltung zeigen wie bei der Durchsetzung des Rechts in der physischen Welt. Zwischen physischer und nicht-physischer Privatsphäre werden zunehmend Unterschiede gemacht, die sich argumentativ kaum rechtfertigen lassen.
Der Verdacht erhärtet sich, dass wachsende technische Möglichkeiten eine bedenkliche Entwicklung begünstigen könnten. Die Verfahrensgrundrechte der Menschen waren und sind bei der Verfolgung von Gesetzesbrechern hinderlich; sie sind jedoch ein unverrückbares Kennzeichen für jeden modernen Rechtsstaat und wurden immer wieder von allen wesentlichen politischen Kräften und Gerichten bekräftigt. Dies galt sowohl im physischen als auch im elektronischen Privatraum gleichermaßen. Diese nun in einem Teilbereich aufzuweichen erfordert eine Grundsatzdiskussion und darf nicht aufgrund verlockender technischer Möglichkeiten und verführerisch winkender Gelder geschehen. Die Gier nach Geld stellt weder für Privatpersonen noch für den Staat eine Rechtfertigung für unethisches Verhalten dar.
Es stellt sich die Frage, ob es sich bei der Aufweichung der Privatsphäre des finanziellen Haushalts um eine isolierte Maßnahme handelt, um Steuerehrlichkeit zu erzwingen oder ob dahinter ein wesentlich umfassenderes Thema zur Machtsicherung von Regierung und Verwaltung steht? Nicht zuletzt seit den Enthüllungen des US-Whistleblowers Edward Snowden lässt sich das massive Interesse an Daten durch europäische Regierungen nicht mehr leugnen. Nicht nur britische Behörden haben eng mit US-Geheimdiensten zusammengearbeitet und dabei fleißig Daten über ihre eigenen Bürger gesammelt und ausgewertet; auch deutsche Behörden haben intensiv mit US-Geheimdiensten kooperiert – trotz einer Verfassung, die staatliche Macht stark einschränkt – indem sie regelmäßig Daten von amerikanischen Freunden bezogen haben, welche sie gemäß Verfassung selbst über ihre eigenen Bürger gar nicht hätten sammeln dürfen. Vieles deutet darauf hin, dass hinter dem Datenhunger auch europäischer Regierungen weit mehr steckt als das wohlmeinende Interesse an einer Sicherstellung von Steuern für das Gemeinwesen.