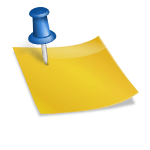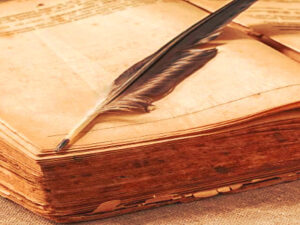Die Privatisierung und Ökonomisierung des Luftverkehrsmarktes

Der Ausdruck der zunehmenden Ökonomisierung des deutschen Luftverkehrsmarktes zeigt sich unter anderem in der Privatisierung des »Flagcarriers« der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Lufthansa. Bis in die 1980er-Jahre hatte die Bundesregierung das Recht, einen gesellschaftsrechtlichen Einfluss auf die deutschen Linienfluggesellschaften, einschließlich der Lufthansa, auszuüben. Dieser Einfluss basierte auf der gesellschaftlich anerkannten Verantwortung des Staates, den Luftverkehrsdienst bereitzustellen und dessen Sicherheit zu gewährleisten.
Staatliche Einflussnahme bis in die 1980er-Jahre
Aus Sicht des Staates war die „Befriedigung“ und „Sicherstellung“ des öffentlichen Luftverkehrsinteresses mit einem Einfluss verbunden, der über die gesetzlichen Kompetenzen im Luftverkehrsbereich hinausging – so die allgemein vertretene Meinung. Bereits beim Börsengang der Deutschen Lufthansa im Jahr 1966 war offensichtlich, dass der staatliche Mehrheitsanteil ein wichtiges Steuerungsinstrument zugunsten der Öffentlichkeit darstellen sollte. Daher hielt die Bundesregierung bis zur Kapitalerhöhung im Jahr 1978 an ihrer Politik einer mehrheitlichen Beteiligung fest, wobei bis zu diesem Zeitpunkt etwa 75 Prozent der Anteile in staatlichem Besitz waren.
Der Trend zur Deregulierung und erste Privatisierungsmaßnahmen
Der weltweite Trend zur Deregulierung im Luftverkehr, dessen Ursprünge in den USA lagen, war schließlich ausschlaggebend für die erste Teilprivatisierung der Lufthansa. Mit der zunehmenden Deregulierung entstand erstmals ein Wettbewerb im Linienflugsektor. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, entschloss sich die Bundesregierung, private Investoren einzubeziehen. Im Rahmen weiterer Kapitalerhöhungen Ende der 1980er- und Anfang der 90er-Jahre verringerte sich der Anteil des Bundes an der Lufthansa schrittweise von 75 auf knapp 51 Prozent.
Der Einfluss des europäischen Binnenmarktes und die weiteren Privatisierungen
Neben der fortdauernden Deregulierung des internationalen Luftverkehrs stellte das Inkrafttreten des Vertrags über den europäischen Binnenmarkt im Jahr 1993 einen weiteren Wendepunkt im Privatisierungsprozess dar; dadurch wurde die Legitimität eines Mehrheitsanteils des Bundes an der Lufthansa AG zunehmend infrage gestellt. Im Gegensatz zur bisherigen politischen Ausrichtung verfolgte die EU eine konsequente Politik geringerer Kontrolle und Steuerung von Linienfluggesellschaften durch den Staat. Zudem verstärkten die erheblichen Verluste, die die Lufthansa AG während der Luftfahrtkrise 1992 erlitten hatte, den staatlichen Willen zur weiteren Privatisierung der Fluggesellschaft.
Der letzte Schritt: vollständige Privatisierung der Lufthansa
Um eine wettbewerbsfähige Airline zu gewährleisten, wurde 1997 der letzte Schritt zur vollständigen Privatisierung eingeleitet, als die Bundesregierung die verbliebenen 37,5 Prozent ihrer Anteile an der Lufthansa an die Börse brachte. Einmal mehr entwickelte sich aus einer angekündigten Teilprivatisierung eine Vollprivatisierung.
Privatisierung der Flugsicherung: Widerstand und Hintergründe
Die Privatisierung der Deutschen Flugsicherung (DFS) stieß hingegen auf Widerstand seitens des Bundespräsidialamtes; diese ist gemäß § 27c Absatz 2 Luftverkehrsgesetz für Sicherheit und Pünktlichkeit im nationalen Luftverkehr verantwortlich und überwacht jährlich mehr als drei Millionen Flugbewegungen.
Geschichte und Entwicklung der Flugsicherung in Deutschland
Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Langen wurde im Januar 1993 gegründet und ersetzte die überregionale militärische Flugsicherung sowie die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) als zentrale Kontrollinstanz für den zivilen und militärischen Flugverkehr. Die BFS war bereits 1953 als Teil der Luftverkehrsverwaltung des Bundes ins Leben gerufen worden, um den deutschen Luftraum zu überwachen. Ihre besondere Stellung zeigte sich unter anderem darin, dass damals per Gesetz beschlossen wurde, das überwiegend aus Angestellten bestehende Personal aufgrund ihrer hoheitlichen Aufgaben zu verbeamten. Ziel dieser Maßnahme war es, Arbeitskämpfe und Streiks unter den Lotsen zu verhindern und damit verbundene operative Schwierigkeiten im wachsenden nationalen Flugverkehr zu vermeiden.
Kostenentwicklung und Privatisierung der Flugsicherung
Der Anstieg des Luftverkehrs in Deutschland ging mit steigenden Kosten für die nationale Flugüberwachung einher, was Jahr für Jahr ein Defizit von 100 bis 200 Millionen D-Mark im Budget der Flugsicherung verursachte. Diese Defizite führten dazu, dass die Bundesregierung Anfang der 1990er-Jahre die Privatisierung der Bundesbehörde einleitete; wie bereits erwähnt wurde, wurde die BFS am 1. Januar 1993 in die DFS als Gesellschaft mit beschränkter Haftung überführt.
Organisatorische und finanzielle Aspekte der Privatisierung
Um den Anforderungen des Art. 87 d GG hinsichtlich der Bundesverwaltung des Luftverkehrs gerecht zu werden, änderte sich bei diesem ersten Schritt zur Privatisierung lediglich die Organisationsform, während die Eigentumsverhältnisse unverändert blieben. Um das von der Bundesregierung formulierte Ziel eines finanziell unabhängigen Dienstleistungsunternehmens zu erreichen, erhöhte der Bund das Eigenkapital auf 410 Millionen D-Mark. Der teuerste Aspekt dieser organisatorischen Umwandlung stellte zweifellos die finanzielle Besitzstandsgarantie für das Personal dar. Um die verbliebenen Beamten zum Wechsel in ein Angestelltenverhältnis zu bewegen, musste der Bund erhebliche Gehaltserhöhungen für die Fluglotsen sowie hohe Nachzahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung akzeptieren – auch dies ist eine finanzielle Kehrseite vieler Privatisierungen.
Weiterentwicklung und aktuelle Struktur der DFS
Die DFS bleibt nach wie vor im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und untersteht dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Ursprünglich als Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht gegründet, wurde das kostendeckende Wirtschaften mit der Zeit zum vorrangigen Ziel erklärt. Ausdruck dieser neuen Unternehmenspolitik waren umfassende Rationalisierungen sowie eine deutliche Erhöhung der An- und Abfluggebühren für Navigationsdienste und -einrichtungen.
Expansion und Gesetzesinitiativen zur Privatisierung
Die parallel vorgenommene Expansion des Unternehmens führte dazu, dass die DFS mittlerweile 16 internationale Flughäfen sowie neun Regionalflughäfen überwacht und dabei über ihre Tochtergesellschaft „The Tower Company“ vertreten ist. Eine umfassend diskutierte Wende hin zur Ökonomisierung der Flugsicherung stellte das im Jahr 2005 dem Deutschen Bundestag vorgelegte Flugsicherungsgesetz dar; dieses sollte den Weg für eine Kapitalprivatisierung der DFS ebnen.
Die geplante Kapitalprivatisierung und politische Kontroversen
Im Gegensatz zur rein formellen Privatisierung von 1993 sollte nun eine materielle Kapitalprivatisierung eingeleitet werden; daher ermöglichte das vorgelegte Gesetz den Verkauf von 74,9 Prozent der bundeseigenen DFS-Anteile an private Investoren. Um den Einfluss des Bundes auf die nationale Flugsicherung zu wahren, sollte dem Bund eine Sperrminorität von 25,1 Prozent eingeräumt werden. Die Umsetzung des bereits vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes scheiterte jedoch noch im selben Jahr an dem Veto des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Dieser argumentierte, dass nach geltendem Recht die Flugsicherung eine hoheitliche Aufgabe sei, welche vom Staat selbst wahrgenommen werden müsse, und nicht durch private Unternehmen delegiert werden dürfe.
Perspektiven und europäische Entwicklungen
Hätte Köhler das Gesetz am 24. Oktober 2006 im Bundespräsidialamt unterzeichnet, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit heute mehrheitlich in privatem Besitz gewesen. Diese Annahme erscheint auch deshalb plausibel, weil die von der EU-Kommission im Jahr 2004 formulierte Vision eines »Single European Sky«, also eines einheitlichen europäischen Luftraums, für die DFS eine äußerst attraktive, jedoch kostspielige Wachstumschance darstellt.
Zukunftsaussichten: Privatisierung und Wettbewerbsfähigkeit
Um im Wettbewerb mit anderen europäischen Flugsicherungsunternehmen bestehen zu können, setzen viele Verkehrspolitiker auf eine stärkere Marktorientierung der DFS durch eine Kapitalprivatisierung. In Vorbereitung auf eine solche materielle Privatisierung wurde bereits in Art. 87 GG der Begriff bundeseigene Verwaltung durch „Bundesverwaltung“ ersetzt; somit wird nun durch die Ausstattung privater Akteure mit hoheitlichen Rechten eine Teilprivatisierung der DFS ermöglicht. Einmal mehr stellen die erwarteten Einnahmen von etwa einer Milliarde Euro aus dem Verkauf von drei Vierteln der Anteile einen gewichtigen Grund für den Bund dar, den Prozess zur Privatisierung der Flugsicherung abzuschließen.