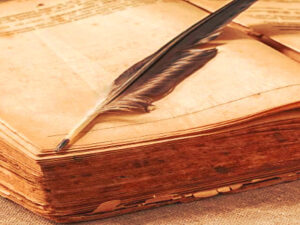Der oft nicht ausreichend beachtete Kostenfaktor der Lkw-Maut

Das deutsche Lkw-Mautsystem „Toll Collect“ wurde ins Leben gerufen, um die stark vernachlässigte und marode Infrastruktur zu sanieren und die Finanzierung der Straßeninstandhaltung gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Bereits im Jahr 1990, unter der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung, wurde der Plan entwickelt, den gewerblichen Güterverkehr durch eine spezielle Lkw-Gebühr an den Kosten für den Erhalt der Verkehrswege zu beteiligen. Ziel war es, die Lasten gerechter zu verteilen und die Finanzierungslücke im Straßenbau zu schließen.
Rechtliche Herausforderungen und erste Anläufe
Allerdings stieß diese Initiative bald auf rechtliche Hürden: Die Gestaltung der Gebühr entsprach damals nicht den Vorgaben des Europäischen Gemeinschaftsrechts, sodass die Einführung kurz nach der ersten Umsetzung wieder gestoppt werden musste. Trotz dieses Rückschlags blieb die Bundesregierung jedoch ihrer Grundidee treu. Sie wollte weiterhin eine Lösung finden, um den Lkw-Verkehr stärker in die Kostenbeteiligung einzubeziehen und die Infrastruktur nachhaltig zu finanzieren.
Im August 1994 wurde in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Niederlande, Belgien, Luxemburg und Dänemark die sogenannte Eurovignette eingeführt – eine Autobahnbenutzungsgebühr speziell für schwere Nutzfahrzeuge. Dabei wurden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt als auch die Gebührenhöhen und die Verteilung der Einnahmen zwischen den Ländern geregelt. Der Aufbau und die technische Umsetzung dieses Systems wurden von Anfang an einem privaten Unternehmen übertragen: der AGES Maut System GmbH & Co. KG, einem Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, Aral und Shell.
Von der Idee zur technischen Umsetzung: Streit und Verzögerungen
Aus Sicht der damaligen Bundesregierung war die reine Zeitabhängige Abrechnung der Maut nicht die optimale Lösung. Bereits 1998 wurde daher angestrebt, eine verursachergerechte, streckenabhängige Maut einzuführen, die die tatsächlichen Kosten der Straßenbelastung besser widerspiegelt. Im Juli 2002 erhielt schließlich das Bieterkonsortium „Electronic Toll Collect“ (ETC) den Zuschlag. Dieses Unternehmen bestand aus den Branchenriesen Daimler Chrysler, Deutsche Telekom und Cofiroute. Ziel war es, ein bundesweit einsetzbares, elektronisches Mautsystem zu entwickeln und zu betreiben – das bislang größte Projekt dieser Art in Deutschland.
Komplexe Vertragsgestaltung und technische Pannen
Der Vertrag mit ETC sah vor, über zwölf Jahre rund 650 Millionen Euro jährlich an Mauteinnahmen zu generieren. Zudem waren bis zu drei Vertragsverlängerungen vorgesehen. Doch der Start des Systems wurde durch zahlreiche technische Probleme erheblich verzögert. Der ursprünglich für den 31. August 2003 geplante Einsatztermin konnte nicht gehalten werden. Stattdessen wurde die vorläufige Betriebserlaubnis erst am 15. Dezember 2004 erteilt, rund 16 Monate später als geplant.
Im Januar 2005 ging das System schließlich mit einer eingeschränkten Funktionalität in Betrieb. Ein Jahr später wurde die volle Funktionsfähigkeit erreicht. Die verspätete Einführung führte zu erheblichen Einnahmeausfällen, was das Bundesverkehrsministerium veranlasste, im Juli 2005 Klage gegen die Betreibergesellschaft Toll Collect zu erheben. Grund war das angebliche Täuschungsverhalten der Betreiber, die die Verzögerungen verschleiert und den Bund arglistig getäuscht haben sollen.
Rechtliche Streitigkeiten und massive Kosten für den Steuerzahler
Der Bund fordert in mehreren Verfahren Schadensersatz in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Bisher haben allein die Gerichtsverfahren rund 136 Millionen Euro gekostet, ohne dass eine endgültige Einigung absehbar ist. Ein außergerichtlicher Vergleich scheiterte maßgeblich am Widerstand des ehemaligen Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer, der auf eine gerichtliche Entscheidung bestand, um mögliche Vorwürfe der Misswirtschaft auszuschließen. Hätte der Bund die Kontrolle über das System selbst übernommen, anstatt auf das private Konsortium zu setzen, wären die Kosten vermutlich deutlich niedriger geblieben.
Vertragsende, erneute Beauftragung und politische Entscheidungen
Im Jahr 2015 lief der ursprüngliche Vertrag aus. Angesichts der enormen Verkehrsmenge – im Jahr 2012 wurden mehr als 330 Millionen mautpflichtige Fahrten auf deutschen Autobahnen gezählt – wäre es wirtschaftlich sinnvoll gewesen, die Maut in Eigenregie zu betreiben. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht zudem vor, die Maut ab 2018 auf alle Bundesstraßen auszuweiten. Damit würde sich die mautpflichtige Strecke von derzeit etwa 13.000 auf über 40.000 Kilometer erhöhen, was den Druck erhöht, das System künftig eigenständig zu steuern.
Trotzdem wurde der Vertrag mit Toll Collect zunächst um drei Jahre verlängert, und das Unternehmen wurde erneut mit der Mauterhebung auf 1.100 Kilometern Bundesstraßen beauftragt. Diese Entscheidung erscheint wenig nachvollziehbar, da das Vertrauen in den Betreiber durch die bisherigen Streitigkeiten erheblich erschüttert ist. Hier ist offenbar eine starke Lobbyarbeit im Spiel, die den politischen Willen beeinflusst hat.
Perspektiven für eine eigenständige nationale Mautverwaltung
Es bleibt die Frage, ob der Bund künftig die Verantwortung für die Maut selbst übernimmt oder weiterhin auf private Dienstleister setzt. Die Erfahrung zeigt, dass eine eigenständige Organisation – beispielsweise durch die Autobahnmeistereien – möglicherweise kostengünstiger und effizienter gewesen wäre. Durch die vielen rechtlichen Streitigkeiten und Verzögerungen wurden jedoch hohe Kosten verursacht und die Effizienz des Systems erheblich beeinträchtigt.
Die Diskussion um eine Pkw-Maut und Privatisierung des Straßenverkehrs
Neben der Lkw-Maut ist auch die Diskussion um eine Pkw-Maut wieder aufgeflammt. Das Konzept, das im Juli 2014 von Bundesverkehrsminister vorgestellt wurde, ist höchst umstritten. Kritiker warnen vor einer möglichen weiteren Privatisierung der Straßeninfrastruktur, die vor allem Investoren zugutekommt. Die sogenannte „Ausländer-Maut“, die in der Boulevardpresse auch spöttisch als „Zwangsabgabe für Ausländer“ bezeichnet wurde, ist teuer in der Erhebung und könnte den europäischen Zusammenhalt gefährden. Nach aktuellen Berechnungen würden die Einnahmen nur bei rund 600 Millionen Euro jährlich liegen – eine Summe, die kaum ausreicht, um die enormen Kosten für den Betrieb eines solchen Systems zu rechtfertigen, geschweige denn die Infrastruktur nachhaltig zu verbessern.
Lektionen aus der Vergangenheit
Insgesamt zeigt die Geschichte des deutschen Mautsystems, wie komplex und problematisch öffentlich-private Partnerschaften in der Infrastrukturfinanzierung sein können. Verzögerungen, rechtliche Streitigkeiten und mangelndes Vertrauen haben die Kosten in die Höhe getrieben und die Effektivität des Systems eingeschränkt. Es bleibt zu hoffen, dass künftig eine transparentere und effizientere Lösung gefunden wird – möglicherweise durch eine stärkere Rückkehr zu staatlicher Kontrolle und Planung. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Infrastruktur nachhaltig gepflegt und finanziert wird, ohne dabei die Steuerzahler unnötig zu belasten.