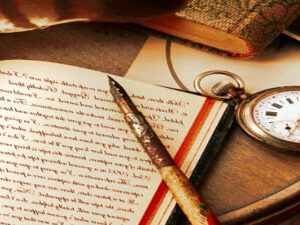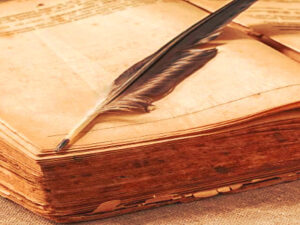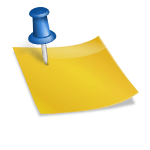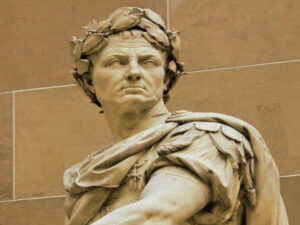Germanicus im Kampf um Germanien – Strategie, Emotionen und Rachefeldzüge der römischen Legionen

Als Germanicus, ein geborener Anführer des römischen Volkes und erfahrener Psychagoge, auf seine aufgewühlten und noch immer zutiefst erregten Soldaten trifft, bleibt ihm zunächst keine Wahl, als den ungestümen Ausbrüchen seiner Legionäre eine neue Richtung zu geben. Statt die ungezügelte Wut ins Leere laufen zu lassen, kanalisiert er sie auf ein neues Ziel: das Land jenseits des Rheins, Germanien. Die Gemüter der Soldaten, noch immer erregt von den vorherigen Unruhen und inneren Konflikten, sehnen sich danach, ihre Schuld und den Schmerz über den Verlust gefallener Waffenbrüder durch Taten zu sühnen. Nur durch ehrenvolle, im Kampf erlittene Wunden auf der eigenen Brust, so glauben sie, könnten die Seelen der Gefallenen versöhnt werden und die eigene Schmach getilgt werden.
Tacitus – Der Chronist und Zeuge der Ereignisse
Diese eindrücklichen Geschehnisse werden nicht von einem fanatischen Militär wie Velleius niedergeschrieben, sondern von Tacitus, einem gebildeten und ehrwürdigen Mann. Er entstammt einer angesehenen Familie, war Ritter, Quästor, Tribun, Ädil, Prätor und schließlich Konsul im Jahr 97 nach Christus. Tacitus schildert die Ereignisse nüchtern und mit analytischem Blick, was den Quellenwert seiner Darstellung noch erhöht und Einblicke in die Denkweise der römischen Führungselite erlaubt.
Der Marsch über den Rhein und die Vorbereitungen zum Angriff
Dem unbändigen Drang seiner Soldaten nachgebend, befiehlt Germanicus den Bau einer Brücke über den Rhein, um das feindliche Gebiet zu betreten. Mit einer gewaltigen Streitmacht von 12.000 Legionären, dazu 26 Kohorten und mehreren Reitergeschwadern der Hilfstruppen, deren Treue im jüngsten Aufstand ungetrübt geblieben war, überschreitet er den Strom. Während die Germanen fernab, in scheinbarer Unbekümmertheit, ihr Leben weiterleben, sind die Römer von Trauer über den Tod des Augustus und von internen Problemen gelähmt und gehemmt. Dennoch marschieren sie entschlossen weiter, durchqueren im Eilmarsch den dunklen Caesischen Wald sowie den von Tiberius errichteten römischen Grenzwall. Dort schlagen sie ein befestigtes Lager auf, sichern Front und Rückseite durch starke Befestigungen und schützen die Flanken mit robusten Verhauen vor Überraschungsangriffen.
Die Wahl des Marschweges und die List der Nacht
Vor ihnen liegt nun die Entscheidung, entweder den bekannten, aber kürzeren Weg zu wählen oder den längeren, unbefestigten und daher vom Feind unbeobachteten Pfad zu beschreiten. Um Überraschung zu gewährleisten und dem Feind zuvorzukommen, entscheidet man sich für den längeren Marsch. Eile ist geboten, denn Späher berichten, dass die Germanen in dieser Nacht ein großes Fest mit Spielen und Gelagen feiern würden. Caecina erhält den Befehl, mit den leicht bewaffneten Kohorten voranzugehen und das Terrain zu sichern, während die Legionen mit angemessenem Abstand folgen. Die Nacht ist klar und voller Sterne – ein günstiges Omen für einen nächtlichen Angriff.
Der Überfall auf die Marsen und der Ausbruch römischer Gewalt
So erreichen die Römer die Dörfer der Marsen, deren Bewohner arg- und schutzlos, ohne jede Wache, schlafend oder noch an den Tischen liegend, von den anstehenden Ereignissen nichts ahnen. Sie sind vom Kriegsgeschehen weit entfernt, in Sorglosigkeit und Trunkenheit verfallen. Für die Römer hätten die vorangegangenen Strapazen und Anstrengungen eigentlich bereits eine gewisse Erschöpfung oder gar Milderung des Blutdurstes bewirken können. Doch es kommt anders: Die Legionen sind durch die aufgestauten Emotionen und Schuldgefühle geradezu bereit, ihre gesamte Wut an den ahnungslosen Germanen auszulassen. Die tief verankerte Überzeugung der römischen Kulturträger besagt: Es liegt allein in der Hand der Götter, zu geben und zu nehmen – und diesmal steht das Zeichen auf Zerstörung und Vernichtung.
Organisation der Verwüstung – Psychologie des Feldzugs
Germanicus teilt seine kampfbereiten Legionen in vier keilförmige Gruppen ein, um die Verwüstung auf möglichst großer Fläche zu verbreiten. Ziel ist nicht der klassische Kampf, sondern die systematische Zerstörung und das Abreagieren der aufgestauten Aggressionen. Es handelt sich um eine gezielt organisierte Ersatzhandlung: Je gewaltiger die Stauung der Emotionen, desto destruktiver die Entladung. Auf einer Breite von 37 Kilometern verwüsten die Römer auf einer Strecke von fünfzigtausend Schritten – das entspricht etwa 75 Kilometern – alles, was ihnen begegnet. Sie verschonen weder Alter noch Geschlecht, weder Heiliges noch Profanes. Das am meisten verehrte Heiligtum der Göttin Tanfana wird vollständig zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Die Römer selbst bleiben unversehrt, denn sie treffen fast ausschließlich auf schlafende, unbewaffnete und hilflose Opfer.
Reflexion über den Blutrausch – Kollektive Schuld und kulturelle Parallelen
Unweigerlich stellt sich die Frage, wie die Römer diesen neu entfachten Blutrausch und die damit einhergehende Schuld wieder loswerden können. Solche Exzesse sind keineswegs auf das römische Volk beschränkt; ähnliche Rasereien gab es auch bei Kelten und Nordgermanen, allerdings zumeist spontan und nicht so kalt und gezielt organisiert wie in diesem Fall. Gerade diese Kälte und Systematik macht das Vorgehen besonders erschreckend und wirft Fragen nach Heilung und Sinn solcher Gewalt auf.
Rückmarsch und neue Herausforderungen
Auf dem Rückweg geraten insbesondere die am Ende der Kolonne marschierenden Kohorten durch plötzlich heraneilende germanische Verbände in ernste Bedrängnis. In dieser kritischen Lage erinnert Germanicus seine Soldaten auf dem Pferd an die Schmach der zurückliegenden Meuterei. Er appelliert besonders an die XX. Legion, diesen Moment zu nutzen, um ihre Schuld durch Tapferkeit und Ehre zu tilgen und die unrühmlichen Ereignisse dem Vergessen anheimzugeben. Schließlich gelingt es, den Rhein zu erreichen und die Legionen weitgehend unversehrt in die Winterquartiere zurückzuführen.
Neue Feldzüge – Wiederholung der Strategie und Entwicklungen im Folgejahr
Im darauffolgenden Frühjahr des Jahres 15 nach Christus setzt Germanicus seine Feldzüge mit ähnlicher Strategie fort, diesmal gegen die Chatten. Im Gegensatz zum Vorjahr fehlen jedoch die emotionalen Motivationsreden. Germanicus geht davon aus, dass die Cherusker durch interne Streitigkeiten, insbesondere zwischen Segestes und Arminius, abgelenkt sind – eine Einschätzung, die sich bestätigt. Den Chatten gelingt es nicht, sich rechtzeitig auf die römische Bedrohung einzustellen. Die Männer, ob jung oder alt, werden entweder gefangen genommen oder getötet. Die jungen Kämpfer versuchen, schwimmend die Eder (Adrana) zu überqueren, um die Römer am Bau einer Brücke zu hindern, werden jedoch mit Wurfgeschossen und Pfeilen zurückgedrängt.
Die endgültige Verwüstung und Rückzug
Friedensverhandlungen werden von den Römern abgelehnt. Dennoch schließen sich einige Chatten dem römischen Heer an, während der Rest in die Wälder flieht und seine Siedlungen aufgibt. Die Hauptsiedlung der Chatten, Mattium (heute Maden), wird niedergebrannt, ebenso das umliegende Land systematisch verwüstet. Nach der vollendeten Zerstörung wendet sich die römische Armee erneut dem Rhein zu, um den Rückmarsch anzutreten.
Die Rolle von Caecina und das Schicksal der Marsen
Inzwischen hat Caecina mit seinen Legionen erfolgreich verhindert, dass die Cherusker den Chatten zur Hilfe eilen konnten. Darüber hinaus hat er die Marsen in einem Gefecht geschlagen, als diese ebenfalls versuchten, sich gegen die Römer zu stellen. Nach den blutigen Nächten der Tanfana-Prozession hätte von den Marsen eigentlich niemand mehr übrig sein dürfen.
Gewalt, Schuld und die Frage nach dem Sinn
Der Feldzug des Germanicus offenbart die komplexe Verbindung von militärischer Strategie, kulturell verankerter Gewaltbereitschaft und dem kollektiven Bedürfnis nach Schuldablösung durch Zerstörung. Die Geschehnisse werfen drängende Fragen nach Moral, Sinn und den psychologischen Mechanismen von Rache und Heilung auf – Themen, die Tacitus mit scharfem Blick herausarbeitet und die bis heute zum Nachdenken anregen.