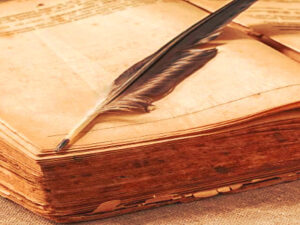Anspruch auf informationelle Selbstbestimmung: Worüber handelt es sich eigentlich?

Es bleibt nach wie vor vollkommen unklar, welche konkreten Absichten und Zielsetzungen die verantwortlichen Behörden tatsächlich mit den immer weiter ausgebauten und zunehmend detaillierten Informationen verfolgen können, die ihnen durch den automatischen Informationsaustausch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zunehmend zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten, die über die finanziellen Verhältnisse der Bürger gesammelt werden, sind für die Behörden zwar zugänglich, doch es ist offen, welche konkreten Strategien und Maßnahmen daraus abgeleitet werden sollen. Das Problem besteht darin, dass der einzelne Bürger sich – wie bereits ausführlich erläutert wurde – darauf einstellen muss, dass die persönlichen Daten und Informationen über ihn nicht ausschließlich zur Überprüfung seiner Steuerpflicht, zur Sicherstellung der Steuerhinterziehung oder zur Kontrolle der Steuererklärung verwendet werden. Vielmehr besteht die Befürchtung, dass diese Daten auch in anderen Zusammenhängen genutzt werden könnten, die bislang noch unklar sind oder noch nicht offen kommuniziert wurden.
Einschränkungen bei der Erfassung inländischer Konten
Sollten die Behörden nur Informationen über Konten im Inland erhalten, also nur Daten zu Vermögenswerten innerhalb des eigenen Landes, so ist es höchstwahrscheinlich nicht möglich, das offiziell angestrebte Ziel – nämlich die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht – vollständig zu erreichen. Denn ein unehrlicher Bürger, der seine Steuerpflicht umgehen möchte, hat es im Zeitalter der globalisierten Finanzwelt leicht, Konten in anderen Ländern zu eröffnen, die außerhalb des Zugriffs der heimischen Steuerbehörden liegen. Deshalb ist es notwendig, auch diesen Punkt unter Kontrolle zu bringen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Politik und die verantwortlichen Entscheidungsträger sich mit mehreren Nachteilen konfrontiert sehen: Zum einen werden der Gesellschaft zusätzliche und teilweise erhebliche Kosten aufgebürdet, ohne dass sich die Steuererträge in einem vergleichsweise nennenswerten Umfang erhöhen. Diese Entwicklung ist fragwürdig, weil die Kosten-Nutzen-Bilanz für die Gesellschaft insgesamt eher negativ ausfällt.
Privatheit versus staatliche Überwachung
Neben dieser eher wirtschaftlichen und fiskalischen Problematik schafft die Politik durch den Ausbau der Überwachung und den Zugriff auf persönliche Finanzdaten eine gefährliche Grundlage: Sie öffnet damit Türen, um in sehr private Bereiche des Lebens der Bürgerinnen und Bürger Einblick zu nehmen. Diese Entwicklungen werfen bedeutende Fragen hinsichtlich der Privatsphäre und der Grundrechte auf. Es ist eine Diskussion darüber notwendig, inwieweit der Staat das Recht haben sollte, die Vermögensverhältnisse der Menschen in der Tiefe zu kennen – und zwar nicht nur im Rahmen der Steuerkontrolle, sondern auch darüber hinaus. Mit zunehmender Überwachung steigt die Gefahr, dass in die Privatsphäre eingegriffen wird, die eigentlich durch Grundrechte geschützt ist. Die Balance zwischen staatlicher Kontrolle und individuellem Schutz der Privatsphäre ist in diesem Zusammenhang äußerst schwierig und sensibel.
Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Stabilität
Darüber hinaus kann eine solche Vorgehensweise auf gesamtwirtschaftlicher Ebene auch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Eine verstärkte Überwachung, die Steuerflucht erschweren soll, könnte unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben: Sie könnte dazu führen, dass Kapitalflucht begünstigt wird und Kapital in weniger qualitätsvolle, weniger regulierte Finanzplätze abwandert. Diese Entwicklung ist problematisch, weil sie die Stabilität und das Vertrauen in das eigene Finanzsystem gefährdet. Eine vernünftige und verantwortungsvolle Finanzpolitik sollte grundsätzlich verhindern, dass Kapital unkontrolliert das Land verlässt, um die eigene Wirtschaft zu stärken und den Wohlstand innerhalb des Landes zu sichern. Es ist jedoch ebenso wichtig, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu respektieren, ihr Vermögen im Ausland zu halten, wenn sie dies möchten. Diese Freiheit gehört zu den Grundrechten und sollte nicht willkürlich eingeschränkt werden.
Vertrauen in die politische Lage als Kapitalpuffer
Das Maß der Kapitalabflüsse ins Ausland ist ein guter Indikator für das Vertrauen in die politische Stabilität eines Landes. Wenn die Menschen vermehrt Gelder ins Ausland transferieren, deutet dies auf eine geringe Zufriedenheit mit der politischen Lage hin. In einem solchen Fall sollte die Regierung ihre Anstrengungen darauf richten, die politische Stabilität und die gesellschaftliche Vertrauensbasis zu stärken, anstatt durch Zwangsmaßnahmen diese Abflüsse zu unterbinden. Das Kapital, das im Ausland deponiert ist, kann in Krisenzeiten auch als eine Art „Rückversicherung“ dienen: Falls das Land durch verantwortungslose Machthaber erschüttert wird, die Vermögenswerte zerstören oder plündern, können die im Ausland gehaltenen Gelder zumindest für den Wiederaufbau und die Stabilisierung der Wirtschaft genutzt werden. Diese Überlegung ist kein theoretisches Gedankenspiel, sondern basiert auf einer Vielzahl bitterer historischer Erfahrungen in Ländern weltweit, in denen solche Szenarien tatsächlich eingetreten sind.
Historische Beispiele für Vermögen im Ausland
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses wurde keineswegs ausschließlich durch den Kapitalzufluss über den bekannten Marshall-Plan ermöglicht. Es erhielt auch entscheidende Impulse durch Vermögenswerte, die rechtzeitig vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Sicherheit gebracht wurden. Diese Vermögenswerte gelten heute als sogenannte Schwarzgelder. Es gibt belegbare Hinweise darauf, dass bereits vor dem Ersten Weltkrieg Gelder mit offizieller Genehmigung in die Schweiz und nach Liechtenstein transferiert wurden. Diese Gelder, die in krisenhaften Zeiten in Sicherheit gebracht wurden, haben zum Wiederaufbau des Landes beigetragen. Trotz dieser positiven Aspekte sehen sich die Eigentümer dieser Vermögenswerte heute teilweise mit unangenehmen Fragen konfrontiert, beispielsweise im Zusammenhang mit Steuerfragen oder der Frage nach der Herkunft der Gelder.
Verantwortung der Regierung im Umgang mit Vermögen im Ausland
Wenn man die von Kriegen, gescheiterten Ideologien und politischen Umbrüchen geprägte Geschichte betrachtet, sollte es in der Verantwortung einer jeden verantwortungsvollen Regierung liegen, möglichst wenig über die Vermögenswerte ihrer Einwohner im Ausland zu wissen. Oder kann ein Regierungschef für alle zukünftigen Nachfolger garantieren, dass er oder sie selbst für alle Zeiten die Kontrolle über alle Vermögenswerte behält? Diese Frage ist zentral, weil in der Vergangenheit immer wieder gezeigt wurde, dass in bestimmten Ländern, wie beispielsweise in der Schweiz, den USA oder Kanada, die Vermögenswerte der Bürgerinnen und Bürger in besonderem Maße vor autoritären Regimen, vor kriegerischen Konflikten oder vor Eroberung durch andere Mächte geschützt wurden. Diese Schutzmechanismen haben dazu beigetragen, den Wohlstand und die Stabilität in diesen Ländern zu sichern.
Risiken des Verlustes von Ersparnissen durch politische Maßnahmen
Doch diese Situation ist eher die Ausnahme als die Regel. Historisch betrachtet hat das Kapital der Bürger, das der Regierung nicht zugänglich war, in vielen Fällen mehr Nutzen als Schaden gebracht. Der Verlust von Ersparnissen tritt häufig bereits durch die einfache Überschuldung eines Landes ein, beispielsweise durch Staatspleiten oder Finanzkrisen. Ein Beispiel dafür ist Argentinien im Jahr 2008, als die Regierung die Verstaatlichung privater Pensionskassen durchführte, um einen drohenden Finanzierungsengpass zu überbrücken. Viele Menschen sehen diese Maßnahmen kritisch, weil sie die Sicherheit ihrer Altersvorsorge gefährden und das Vertrauen in das Finanzsystem erschüttern. Die hohe Inflation, die das Land im vergangenen Jahrzehnt durchlebt hat, hat zudem die Rentnerinnen und Rentner stark belastet. Die staatliche Sozialversicherung, in diesem Fall die argentinische Behörde ANSES, sieht sich mittlerweile mit etwa 450.000 Klagen von Rentnerinnen und Rentnern konfrontiert, die ihre Renten zurückfordern.
Risiken in Spanien: Wirtschaftskrise und Staatsdefizite
Auch in Spanien besteht durch die schwere Wirtschaftskrise und das damit verbundene wachsende Staatsdefizit ein erhebliches Risiko für die Absicherung der Renten. Das Land besitzt zwar einen gut dotierten Reservefonds, der bereits 2012 zur Überbrückung finanzieller Engpässe herangezogen werden musste. Dieser Fonds wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiterhin eine Finanzierungslücke aufweisen, da die Zahl der Beitragszahler sinkt, während die Zahl der Rentenempfänger steigt. Kritisch ist hierbei vor allem, dass der Großteil des Fonds – nämlich etwa 97,4 Prozent – in spanischen Staatsanleihen investiert ist. Das bedeutet, dass der Fonds zunehmend zu einem Instrument wird, mit dem die Regierung den Haushalt finanziert, anstatt eine echte Risikostreuung vorzunehmen.
Unzureichende Risikodiversifikation und Risiken der Staatsschulden
Es ist alarmierend, dass bei diesem Reservefonds keine ausreichende Risikodiversifikation vorgenommen wird. Keine seriöse Privatbank würde ihre Gelder so einseitig in eine Anlageform investieren, die mit erheblichen Risiken verbunden ist, wie die Entwicklung spanischer Staatsanleihen seit einigen Jahren deutlich macht. Die Renditen dieser Anleihen sind volatil, und in Krisenzeiten steigen die Risiken erheblich an. Es bleibt zu hoffen, dass in Anbetracht der aktuellen Verschuldungskrise in der Europäischen Union sowie in den USA Lösungen gefunden werden, die eine weitgehende Verarmung der Bürgerinnen und Bürger verhindern. Unabhängig von der Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Scheiterns ist jedoch klar, dass die Risiken deutlich höher sind als die Risiken eines kleineren Unfalls, etwa eines Hausbrands oder eines Beinbruchs, gegen die man sich durch Versicherungen absichern kann.
Versicherung gegen Risiken und die Gefahr der schleichenden Enteignung
Selbst wer optimistisch ist und davon ausgeht, dass eine erfolgreiche Sanierung der öffentlichen Haushalte ohne Zwangsmaßnahmen gegen den Normalbürger zu 99 Prozent gelingen wird, muss die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei nur einem Prozent sehen. In dieser Größenordnung erscheinen jedoch Zwangsmaßnahmen – etwa die Enteignung von Vermögen, Steuererhöhungen oder Kapitalverkehrskontrollen – deutlich wahrscheinlicher. Diese Maßnahmen sind meistens mit erheblichen Eingriffen in die Eigentumsrechte verbunden und stellen eine erhebliche Gefahr für die Vermögenssicherung der Bürgerinnen und Bürger dar.
Schutz vor schleichender Enteignung durch Inflation und Zwangsmaßnahmen
Es ist selbstverständlich nachvollziehbar, dass man sich gegen Feuerschäden absichert, indem man eine entsprechende Versicherung abschließt und dafür hohe Prämien zahlt. Die größeren Risiken für die Ersparnisse sind jedoch nur schwer versicherbar, insbesondere die schleichende Enteignung durch Inflation oder durch staatlich verordnete Zwangsmaßnahmen. Diese Risiken sind für den einzelnen Sparer kaum kalkulierbar und oft kaum gegen Maßnahmen des Staates oder durch Währungsabwertung absicherbar. Möchte der Sparer sein Vermögen ins Ausland transferieren, sieht er sich häufig hohen Hürden gegenüber, oft aufgrund von staatlichen Verbotsregelungen oder formal rechtlichen Einschränkungen in zahlreichen Ländern.
Die Problematik der vollständigen Offenlegung persönlicher Vermögenswerte
Wäre es gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Bürger dem Staat seine gesamten Ersparnisse und Vermögenswerte offenlegt, so müsste man dies als eine höchst fahrlässige Handlung betrachten. Es ist kaum vorstellbar, dass ein vernünftiger Mensch sich freiwillig in eine Situation begibt, in der er durch die Offenlegung all seiner Vermögenswerte seine Privatsphäre und seine Sicherheit aufs Spiel setzt. In keinem anderen Bereich, bei vergleichbarer Tragweite und Wahrscheinlichkeit, verzichtet ein Mensch auf eine entsprechende Versicherung. Es geht hier um fundamentale Fragen, welche für den Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes von entscheidender Bedeutung sind. Diese Überlegungen gehen weit über steuerliche Vorteile hinaus. Wer Menschen pauschal vorwirft, sie handelten aus niederen Motiven, handelt unfair und trifft die Sache nicht richtig – denn in vielen Fällen war die Vorgehensweise der Betroffenen durchaus sinnvoll und nachvollziehbar, wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat.
Wahrung der Privatsphäre und die Risiken staatlicher Überwachung
Es sind bekannte Fälle, in denen Menschen Vermögen im Ausland vor staatlicher Kontrolle und Zugriff schützen wollten, um ihre Privatsphäre zu wahren. Allgemein wird oft angenommen, dass nur reiche Menschen diese Praktiken nutzen, um ihr Vermögen vor Steuern oder vor staatlichen Eingriffen zu sichern. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Das sogenannte „Steuerschlupfloch“ ist für viele Menschen eine wichtige Option, um ihre Ersparnisse vor unrechtmäßigen Zugriffen und ungerechtfertigten Forderungen zu schützen. Der Idealfall wäre es, wenn der Staat in der Lage wäre, seine berechtigten Steuereinnahmen zu generieren, ohne den Bürgerinnen und Bürgern grundlegend bewährte Möglichkeiten zur Wahrung ihrer finanziellen Privatsphäre zu nehmen. Es gibt verschiedene Ansätze, um diese Balance zu finden; einige werden in späteren Abschnitten noch behandelt werden.
Politische Entscheidungen und ihre Folgen für die Privatsphäre
Während kleinere, neutrale Länder wie die Schweiz, Liechtenstein oder Österreich versuchten, Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Steuerbehörden mit den notwendigen Informationen versorgen als auch die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger wahren, wurden diese Vorschläge von Ländern wie den USA, Frankreich oder Deutschland abgelehnt. Selbst ein zwischen Deutschland und der Schweiz ausgehandelter Steuerabkommen-Entwurf wurde letztlich im deutschen Bundestag abgelehnt, weil er die Privatsphäre der Steuerpflichtigen zu stark einschränken und sie schlechter stellen würde als andere Bürger mit Recht auf Privatsphäre. Im Dezember 2012 scheiterte auch im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag eine Einigung über eine tragfähige Lösung. Es ist deutlich erkennbar, dass politische Entscheidungsträger in vielen Ländern vor allem darauf abzielen, den Behörden möglichst viele Informationen über die Vermögensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Dabei greifen sie jedoch tief in fundamentale Rechte ein, insbesondere in das Recht auf Privatsphäre und den Schutz persönlicher Daten. Das Ziel vieler nicht deklarierter Gelder ist nicht primär die Steuerersparnis, sondern der Schutz vor staatlichen Übergriffen, Verfolgung oder anderen Risiken.
Abwägung zwischen staatlichem Funktionieren und individuellen Rechten
Wenn es für das Funktionieren eines Staates notwendig erscheint, gewisse Privatsphärenrechte einzuschränken, so sollte die Gesellschaft bereit sein, eine entsprechende Güterabwägung vorzunehmen. Dabei steht das kollektive Interesse an einem funktionierenden Staat und einer funktionierenden Steuerverwaltung im Mittelpunkt. Doch ist dies in der Praxis wirklich der Fall? Reichen dazu nur wenige Informationen über Kontostände oder Erträge aus, oder sind tiefgreifendere Maßnahmen notwendig? Welche zusätzlichen Schritte sind erforderlich, um eine deutlich bessere Steuermoral und mehr Vertrauen in das Steuersystem zu erreichen? Und vor allem: Sind wir bereit, diese zusätzlichen Maßnahmen auch tatsächlich einzufordern? Diese Fragen stellen sich, weil die Balance zwischen staatlicher Kontrolle und dem Schutz der persönlichen Freiheit eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist.